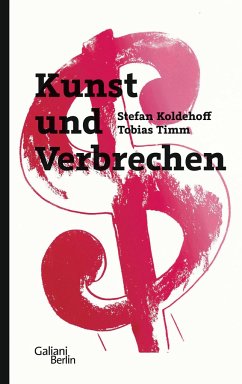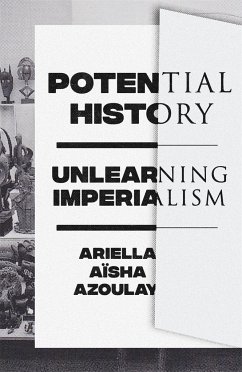griechischen Kunst und der gleichzeitigen Einsicht in deren notwendige Historisierung sollte zu den schwierigsten, aber auch produktivsten Herausforderungen des Winckelmannschen Unternehmens werden. Der Kunstgeschichte war damit bereits in einem ihrer Gründungstexte eine Konstellation mit auf den Weg gegeben, die ihre Erklärungsmodelle bis heute entscheidend mitbestimmt: Die historische Ordnung der Kunst soll einer nachvollziehbaren Logik folgen, diese Logik wird aber durch Werturteile getragen, die aus der historischen Entwicklung alleine nicht begründbar sind.
So haben sich auch für die Kunst der Moderne Erzählmuster durchgesetzt, deren Plausibilität auf normativen Entscheidungen beruht - etwa der Überzeugung, dass künstlerische Selbstreflexivität ästhetisch oder ethisch höher zu bewerten sei als eine um Wirklichkeitstreue bemühte Kunst. Für diese Überzeugung lassen sich zweifellos Gründe nennen, das ändert aber nichts daran, dass es sich eben um eine Anschauung handelt, nicht um eine in der Geschichte vorgefundene Tatsache. Der an der Nürnberger Kunstakademie lehrende Philosoph und Kunsthistoriker Christian Demand hat den Zusammenhang von Genealogie und Werturteil jetzt zum Gegenstand einer lesenswerten Untersuchung gemacht. "Wie kommt die Ordnung in die Kunst?", fragt Demand ebenso direkt wie allumfassend und zielt damit auf eine grundsätzliche Befragung gängiger Erklärungsmodelle moderner Kunst.
Am Beginn steht eine Reihe von Museumsbesuchen des Autors. Sie enden in der ernüchternden Erkenntnis, dass beinahe alle Museen denselben kunsthistorischen Kanon präsentieren, obwohl der überlieferte Bestand auch eine ganz andere Ordnung gerechtfertigt hätte. Demand erinnert daran, dass Alfred Barr, Direktor des Museum of Modern Art, in den dreißiger Jahren noch ein Museum forderte, das "wie ein Torpedo" durch die Zeit gleiten solle, zeitgemäße Werke aufnehmen, aber immer wieder auch alte abstoßen müsse. Wenige Jahre später war der pfeilschnelle Torpedo auf Schritttempo heruntergefahren, und die Moderne hatte sich zu einem festen Kanon mit Haupt- und Nebenmeistern verfestigt, dem man jeweils die neuesten Produktionen noch anstückte. "Da schwören die Theoretiker der Moderne ihr Publikum jahrzehntelang emphatisch auf den ästhetischen Ausnahmezustand ein, sprich: auf Revolution in Permanenz . . . und was kommt dabei heraus? Eine so vorhersehbare wie ermüdende Reihung der immer gleichen Werke und Namen." Die einfachste Erklärung für diese Gleichförmigkeit wäre es gewesen, dass die Museen eben die Entwicklung widerspiegeln, die sich tatsächlich auch so zugetragen hat. Was wie eine naturhistorische Ordnung daherkommt, beruht nach Demand aber nicht auf einer kunstimmanenten Logik, sondern wird im Wesentlichen aufgrund ethischer Überzeugungen, Geschmacks- und Werturteile hergestellt. Die historische Ordnung, die sich als "Geschichte der modernen Kunst" etabliert hat, ist das Produkt der ihr vorangestellten Urteile und Wertungen.
Demands Kronzeuge ist Ernst Gombrich, dessen "Geschichte der Kunst" zu den auflagenstärksten Büchern der Disziplin gehört. Gombrich beginnt seine Entwicklungsgeschichte mit einer entschiedenen Absage an alle normativen Wesensbestimmungen der Kunst. Nicht die Geschichte "der Kunst" wolle er schreiben, sondern die Geschichte der Künstler und ihrer konkreten Problemlösungen. Wie Demand überzeugend demonstriert, fällt Gombrich freilich immer wieder hinter sein methodisches Credo zurück. Seine Erzählung folgt dem normativen Muster einer nach stetiger Illusionssteigerung strebenden Kunst, in der Michelangelo als Meister reüssiert, während Joseph Beuys als bloße "Mode" kurzerhand aus dem Kanon verabschiedet wird. Zu Recht fragt Demand, wodurch diese Trennung von Kunst und Mode theoretisch abgesichert ist und wer oder was eigentlich das rätselhafte "Wir" sein soll, das Gombrich als Konsens stiftendes Kollektiv offenbar immer hinter sich weiß. Im Sinne Demands wäre freilich nichts gewonnen, wollte man die künstlerische Punkteskala einfach ein wenig liberaler handhaben. Denn "unter den Bedingungen der Moderne ist die Forderung nach einer verbindlichen Trennlinie zwischen beliebiger und notwendiger Innovation äußerst schwer einzulösen".
Was folgt nun daraus? Angesichts der Grundsätzlichkeit, mit der Demand an den Start geht, nehmen sich seine Schlussfolgerungen merkwürdig verhalten aus. Der Autor kritisiert die Expertenkultur, die ihre vermeintliche Überlegenheit letztendlich nicht begründen kann, und rät zur allgemeinen Mäßigung. Gemessen an der polemischen Grundausstattung des Buches hätte man hier ein wenig mehr intellektuelle Sprengkraft erwartet - in jedem Fall aber eine genauere historische Analyse. Denn auch wenn Demand mit einigen Abstechern bei Schiller, Hume oder Kant vorbeischaut, ist nicht nachvollziehbar, warum Gombrichs "Geschichte der Kunst" die Beweislast für eine Diskursformation tragen soll, die angeblich seit zwei Jahrhunderten die Rede über Kunst bestimmt.
Die Kunstwissenschaft, so hat der Kunsthistoriker Stefan Germer vor Jahren notiert, müsse durch eine Auflösung ihrer Gewissheiten und die Skepsis gegenüber dem unbedingten Wahrheitsanspruch des Historischen bestimmt sein. Demands Buch ist ein wichtiger Beitrag zu diesem work in progress. Es leistet eine Kritik von Denkfiguren, die nicht schon dadurch Überzeugungskraft erlangen, dass sie als kunsthistorisches Mantra der Moderne unablässig wiederholt werden. Um am Ende zu sagen, dass Werturteile "immer wieder neu ausgehandelt" werden müssen, wäre allerdings auch ein kürzerer Anlauf lang genug gewesen.
PETER GEIMER
Christian Demand: "Wie kommt die Ordnung in die Kunst?". zu Klampen Verlag, Springe 2010. 286 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.08.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.08.2010