und Müll" sexuell am Brodeln ist, wird an die Romanoberfläche strudeln.
Justin investiert das väterliche Erbe in Sex-Experimente; wie noch bei jedem Faust geht die Suche nach dem ultimativen Kick, dem erfüllten Augenblick, in die Hose. Carly, die "turbogeile Tussi", beklaut ihren smarten Freund Steve, um sich neue Klamotten, Sexspielzeuge oder Körperteile ("Unfassbar, dass mein Arsch noch Mode ist") zu kaufen. Wenn Steve erzürnt anale "Gerechtigkeit" fordert, lässt sie sich klaglos auf den Tausch-Verkehr ein; aber Sexmaschinen geben ihr letztlich mehr als Männer, und so reitet sich Carly auf dem japanischen Spitzenmodell White Love 1000 regelrecht zu Tode.
Colin kündigt seinen Uni-Job, um etwas ausgefallenere Fantasien ausleben zu können, und wird sehr böse, als Rebecca nicht abtreibt. Die Stripperin mit dem Dostojewski-Tick geht eigentlich Justin bei der Suche nach dem Glück zur Hand. Ihr Verehrer Johnny legt beim Pornogucken lieber Hand an sich selbst. "Mein Gott", sagt er, "die Liebe ist, als würde man Formaldehyd trinken oder den Kopf unter gefrierendes Wasser tauchen." Joe Stretch lässt wahrlich keine Perversion aus. Es gibt lustlosen Anal- und Telefonsex, Vergewaltigungsspiele, Sex mit Promis und Maschinen. Köpfe und Silikonbusen scharfer Starlets lassen sich beliebig abschrauben und austauschen. Menschen sind unvollkommene Sexmaschinen: Sie können aus der Mode kommen, sterben und gebären. Am Ende von "Friction" (der deutsche Titel "Widerstand" ruft falsche politische Assoziationen wach) haben die sechs Sexmaniacs aus den Kampf- und Partyzonen Manchesters ihren Verstand, ihr Gedächtnis oder ihr Leben verloren, nicht aber den Traum von wahrer Liebe. Romantik mag nur die Gleitcreme einer toll gewordenen Pornokratie sein, aber "die Natur" ist stärker als das Brodeln im Hirn.
Der fünfundzwanzigjährige Sänger der "ElectroDeath-Pop"-Gruppe Performance aus Manchester bezeichnet seinen ersten Roman als "schwarze Komödie sexueller Missgeschicke" und "Clockwork Orange fürs 21. Jahrhundert". Die Sex-"Krankheit der Jugend" führt mindestens seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert zu Mord und Selbstmord. Bret Easton Ellis hat vor über zwanzig Jahren erschöpfend beschrieben, wie sich die Generation Cool mit Drogen, Promiskuität und Gewalt zu Tode amüsiert. Und dass die Liebe möglicherweise die letzte Insel im Stillen Ozean des Maschinensex ist, hat ein Franzose, der hier als "Michel Dingsbums" auftaucht, auch schon angedeutet. Stretch mag ein origineller Popmusiker sein, als Popliterat ist er nur Houellebecq-Epigone.
Selbst die Erzählkonstruktion ist geklaut: Wo bei Houellebecq ein geklonter Neo-Mensch melancholisch gerührt und moralisch geschüttelt auf die letzten Zuckungen der Menschheit herabschaut, beschreibt hier ein hospitalisierter, aber immer noch ziemlich lauter und hibbeliger Erzähler aus der Zukunft mit einer Mischung aus Verachtung, Verständnislosigkeit und Sehnsucht das Elend einer Zeit, als Sexmaschinen noch den Takt für das aufgebrezelte "Formfleisch" der Lebenden schlugen. Theo heißt er, und er geriert sich mal als angewiderter Historiker, mal als lustvoll teilnehmender Beobachter der Alltagsorgien. Theo stöhnt und höhnt, seufzt und jubelt und tut dabei immer so, als wollte er den Leser auf seinem Rücken durch den Sumpf tragen: "Die Wahrheit will, dass wir zu dritt herummachen. Uns abwechselnd huckepack nehmen." In Wahrheit ist er nur ein angehender Popstar, der so gut aussieht und mindestens so böse sein will wie Jim Morrison.
Wie Houellebecq verkündet auch Joe Dingsbums ständig die Apokalypse. Schon zieht das Zeitalter des gentechnisch optimierten Automatensex herauf, aber auch die Gegenreaktion, Fundamentalismus islamistischer oder abendländisch-romantischer Provenienz, lässt nicht auf sich warten. Stretchs Protagonisten sind freilich nicht die alternden Intellektuellen, die unter dem neoliberalen Fitness-, Sex- und Jugendkult leiden, sondern deren blutjunge, ahnungslose Elementarteilchen. Das macht "Widerstand" härter und direkter, aber auch flacher und noch freudloser. Die britische Vergnügungsindustrie hat Phänomene wie Komasaufen oder Happy Bashing längst künstlerisch veredelt, und so muss sich auch Stretchs Roman nicht nur gegen die rauhe Wirklichkeit, sondern auch gegen die Konkurrenz der "Shoppen und ficken"-Literatur behaupten.
Sprachlich ist er seinem Stoff nicht immer gewachsen. Die Rhetorik der Überbietung läuft sich rasch tot, aber der Pegel muss weiter steigen und immer wüstere Satzungeheuer gebären: "Sein püriertes Hirn schlägt Blasen in seinem Pappmaché-Schädel. Das kurzatmige, harte Stakkato der Stretch-Prosa wird immer öfter aufgeweicht von altklugen Kommentaren ("Das Gekicher des 21. Jahrhunderts hat etwas Gespenstisches"), betrunkenen Metaphern ("Die Erfahrung ist ein Schläger im Ballonseidenanzug, der sich selbst verletzt") und augenzwinkernden Fraternisierungsangeboten des sehr auktorialen Erzählers. "Stretch singt, wo andere schreien", rühmt der Verlag. "Sie werden laut aufschreien, wenn sie lesen, was ich sage", verspricht Theo: "Das wird ziemlich lustig." Ziemlich allerdings will hier nichts sein.
MARTIN HALTER
Joe Stretch: "Widerstand". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Volker Oldenburg. Rowohlt Verlag, Reinbek 2008. 381 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
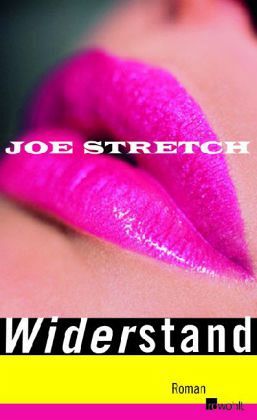




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.07.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.07.2008