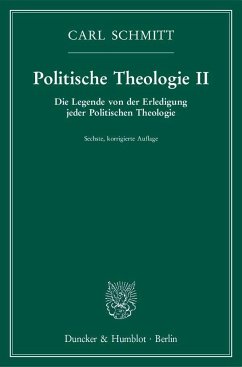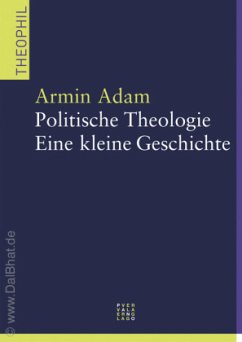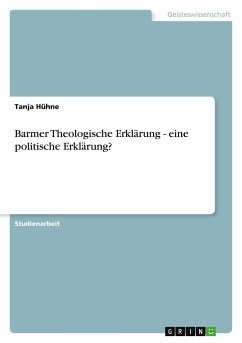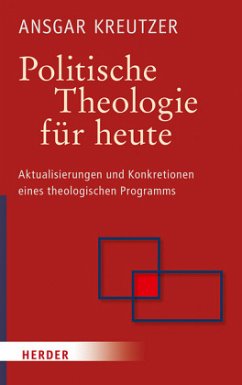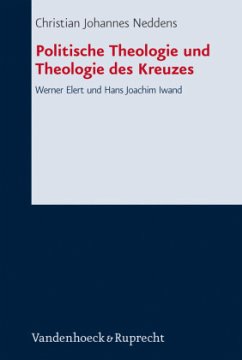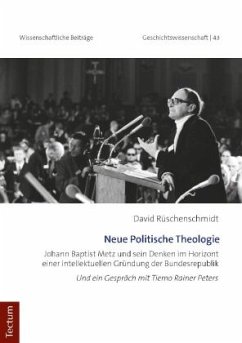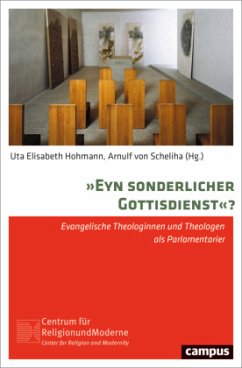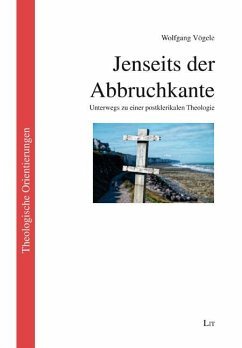Rechristianisierung und Revitalisierung des christlichen Abendlandes und ihrer Kirchen. Dennoch: Die fünfziger Jahre waren die Stunde des politischen Katholizismus. Erfahren und kompetent, gut organisiert, geschlossen und durchsetzungsfähig, nutzte er seine Chance zu politischer Einflußnahme und Mitwirkung.
Wie stand es um den reformatorischen Teil der Christenheit? Gab es einen dem politischen Katholizismus vergleichbaren politischen Protestantismus? Nein, eine vergleichbare "geschlossene Größe" gab es auf protestantischer Seite nicht. Im Unterschied zum Katholizismus, der sich einseitig auf die CDU festlegte, wirkte der Protestantismus "gleichsam verteilt auf die unterschiedlichen politischen Großströmungen". In einem historisch weit ausholenden Überblick zeichnet Michael Klein zunächst die Entwicklungslinien auf, wie sie sich im Verhältnis des Protestantismus zu den großen politischen Strömungen von Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus und politischem Katholizismus seit dem Paulskirchen-Parlament von 1848 herausgebildet haben. "Die sich damals entwickelnden Zuordnungs- und Konfliktverhältnisse sollten ein gutes Jahrhundert weitgehend konstant bleiben."
Prägend für den Protestantismus und die deutsche politische Kultur wurde die Vorstellung vom "christlichen Staat", wie sie von führenden Konservativen im nachrevolutionären Preußen des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Nicht nur die politisch handelnden Akteure, sondern der Staat an sich, als Institution, sollte vom Christentum geprägt sein. Es ging um das Ganze, den christlichen Staat, später um das Volk oder Deutschland. Parteien im modernen Sinne als Organisationen unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessen hatten hier keinen Platz, allenfalls als Weltanschauungsparteien, um das als richtig Erkannte gleichsam missionarisch umzusetzen. Eine religiöse beziehungsweise weltanschauliche Überhöhung des Staates und eine über den Parteien stehende Positionierung der Kirche waren die Folge. "Die Kirche ist politisch neutral", wie Bischof Otto Dibelius in den fünfziger Jahren einmal gesagt haben soll, "aber sie wählt deutschnational."
Die von Klein immer wieder betonte traditionelle Anti-Parteien-Mentalität des deutschen Protestantismus, aber auch die Unfähigkeit, die unterschiedlichen politischen Strömungen und weltanschaulichen Richtungen des Protestantismus in einer bürgerlichen Partei zusammenzuführen und zu organisieren, prägten auch den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. In einem Beschluß aus dem Jahr 1945 definierte die Evangelische Kirche von Westfalen ihr Verhältnis zu den neu entstehenden Parteien und legte entsprechende Leitlinien fest, denen bald die gesamte EKD folgen sollte: "Die Kirche kann sich nicht auf eine politische Partei festlegen, aber auch nicht abseits stehen und den Standpunkt vertreten, sie sei an politischen Dingen nicht interessiert." Mitarbeit in den Parteien wurde durchaus begrüßt. Einer kirchenfeindlichen Partei durfte ein evangelischer Christ jedoch nicht angehören. Die Kirche selbst sollte regelmäßigen Kontakt mit den evangelischen Mitgliedern der verschiedenen Parteien pflegen. Es erschien "nicht ratsam, eine eigene politische Partei zu bilden oder auf deren Bildung hinzuwirken. Es ist endlich nicht erwünscht, daß Geistliche sich an führenden Stellen betätigen."
Detailliert schildert Klein die Gründungsgeschichten von CDU und CSU in den Ländern und Regionen der westlichen Besatzungszonen und untersucht den Einfluß des Protestantismus oder genauer einzelner evangelischer Christen auf Organisation und programmatische Ausrichtung der neuen überkonfessionellen bürgerlichen Partei. Für den national-konservativen Protestantismus war die Lage nicht einfach. Die Gründung einer dezidiert konservativen Partei ließen die Besatzungsmächte nicht zu. Dem politisch-protestantischen Liberalismus stellte sich ebenfalls die Frage, wo und wie er eine neue politische Heimat finden könnte. Nicht anders war es um die christlichen Sozialisten um Jakob Kaiser bestellt. Bereits in den ersten Nachkriegsjahren sollten sich diese Fragen weitgehend zugunsten der von Adenauer geführten CDU klären.
Der FDP gelang es nicht, zur "Sachwalterin" des Protestantismus in Westdeutschland zu werden, wenn auch die Distanz "freundlicher" wurde. Nicht weniger schwierig entwickelte sich das Verhältnis zur SPD. Wegen mangelnder programmatischer Neuausrichtung und Klärung ihrer Position gegenüber den Kirchen blieb die SPD nur für Teile des Protestantismus attraktiv. Auch der Versuch, mit der Deutschen Partei (DP) eine konservativ geprägte protestantische Volkspartei zu schaffen, endete mit der Integration in die CDU zu Beginn der sechziger Jahre. So war und blieb die CDU/CSU als interkonfessionelle Partei offensichtlich die zeitgemäße Antwort auf die konfessionell ausgewogene Situation Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg..
Der politische Protestantismus spaltete sich erneut in die beiden traditionellen Hauptströmungen, den politischen Liberalismus und den Konservativismus. Die Bildung einer großen bürgerlichen Partei war so auch nach 1945 nicht möglich. Aus dieser Differenz wurde nach Klein auch wesentlich die Entstehung von CDU und FDP erklärt. "Hier wie dort lagen die Wurzeln der Auseinandersetzung in einem ungeklärten Verständnis des Christlichen, wobei dieses wiederum als Ergebnis der unterschiedlichen ekklesiologischen Vorstellungen erschien, die sich zeitgleich mit der Entstehung der großen politischen Strömungen 1848 offenbart hatten." Daß sich der Protestantismus dennoch mit dem neuen Staat abfand und an dessen Gestaltung alsbald aktiv mitwirkte, lag an den historischen Umständen, der "christlichen" Union und nicht zuletzt an Konrad Adenauer mit seinem autoritären Führungsstil - Faktoren, die "einen verzögerten, milden Abschied von der Mentalität der politischen Romantik als dominierender protestantischer Sicht der politischen Dinge erlaubten". Die bruderrätliche Richtung habe nach dem Zwischenspiel von Notgemeinschaft und Gesamtdeutscher Volkspartei schließlich in der SPD eine parteipolitische Alternative zur CDU gefunden, so daß sie sich in den westdeutschen Parteienstaat integriert habe.
Michael Klein hat ein grundlegendes Buch zum Verständnis des deutschen Protestantismus und dessen Verhältnis zu den westdeutschen Parteien vorgelegt. Politische Romantik und Anti-Parteien-Affekt in Deutschland erhalten eine fundierte Erklärung. Indem er den Bogen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts spannt, gelingt es ihm, historisches Verstehen und Verständnis für mentale Strukturen zu vermitteln, die über den untersuchten Zeitraum hinaus bis in die Gegenwart wirksam sind.
JOSEF FOSCHEPOTH
Michael Klein: Westdeutscher Protestantismus und politische Parteien. Anti-Parteien-Mentalität und parteipolitisches Engagement von 1945 bis 1963. Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2005. 527 S., 109,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
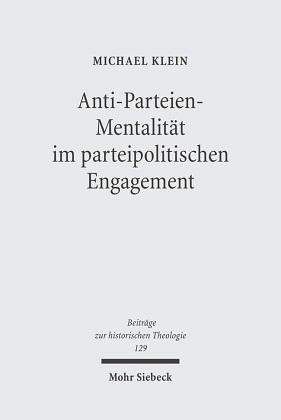




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.09.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.09.2006