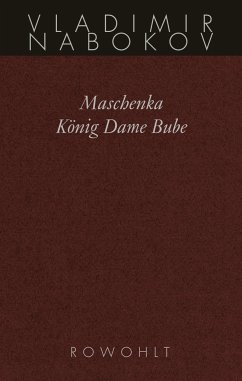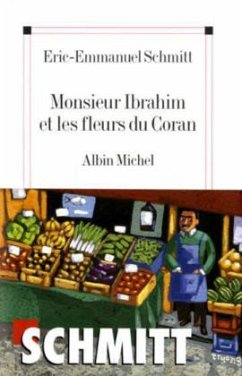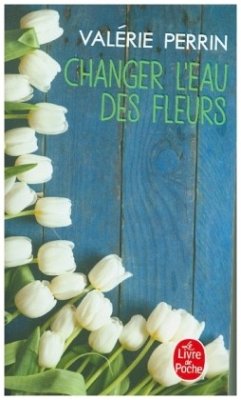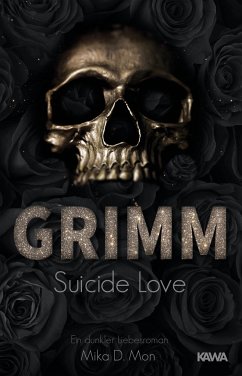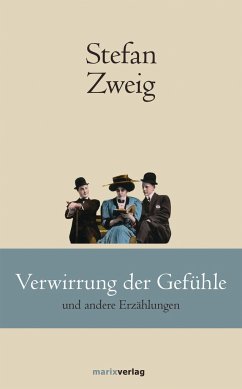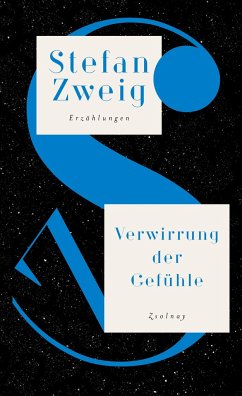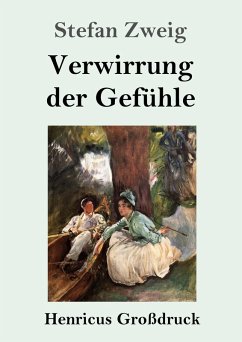plötzlich, "daß das Klopfen in ihren vereinten Händen vom Ticken der Uhr herrührte". Der permanente Wechsel zwischen Pose und Ekstase auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, zwischen Trieborganik und kunstvoller Sprachmechanik, macht Genets Prosawerke über alle epochenbedingt faszinierende Skandalträchtigkeit hinaus dauerhaft interessant: interessanter als seine Theaterstücke, deren Bilder einseitig in der Pose der gespielten Situationen erstarren und auf der Bühne immer wieder enttäuschen.
Der 1942 vorwiegend im Gefängnis entstandene Roman "Notre-Dame-des-Fleurs" war das erste Prosawerk Genets, das nach den Stücken "Die Zofen" und "Unter Aufsicht" 1960 bei Merlin erschien und im berühmten Prozeß wegen Unzüchtigkeit zwei Jahre lang das Hamburger Landgericht beschäftigte. Dabei war der Text schon um jene rund sechzig Stellen gekürzt, die Genet für die fortan maßgebende Gallimard-Ausgabe von 1951 aus den vorherigen kleinen Subskriptionseditionen seines Romans herausgestrichen hatte. Für die bei Merlin nun angelaufene Neuausgabe von Genets Werk in Einzelbänden sind nicht nur die gestrichenen Stellen - einige Worte bis einige Absätze - wieder eingefügt worden. Der Übersetzer Gerhard Hock hat seine ursprüngliche Textfassung neu überarbeitet, was dieser deutschen Version endgültig jene Fluidität der Bilder gibt, die dem Original beispielhaft nahekommt.
Die Sprache ist für den schreibenden Jean in seiner Zelle Opferstatt einer permanenten Transsubstantiation mit seinen Figuren. Bis in die gesprochene oder graphische Wortform hinein werden die Bewegungen der Wirklichkeit nachgezeichnet wie im Namen Nijinsky - "das aufsteigende N, die sich senkende J-Schleife, der Sprung der K-Schleife, der Sturz des Y". Durch dieses mimetische Nachfahren mit Lippe und Hand bringt das schreibende Ich sich in die Erzählung ein bis zur Deckungsgleichheit mit manchen Figuren. Divine etwa "muß mein Alter haben, damit ich endlich mein Bedürfnis lindere, auf einfache Art von mir selbst zu sprechen - wie groß ist mein Verlangen, mich zu beklagen und die Liebe eines Lesers zu gewinnen!"
Gleich zu Beginn des Romans hat der Erzähler den Altar für sein Ritual aufgebaut, indem er mit gekautem Brotteig die aus Magazinen ausgeschnittenen Fotos berühmter Verbrecher auf die Rückseite der Gefängnisordnung klebte und mit Glasperlen schmückte. Abends wird dann, wie man einen Altarflügel öffnet, das Reglement an der Wand umgedreht und die Andacht kann beginnen. Es ist die narrative Andacht vor der Heiligkeit jener leeren Verbrecheraugen, hinter denen die genialische Einfallskraft der kriminellen Phantasie den Erzähler wunderbar schaudern läßt wie die Träume, Flüche und Spuckgeschosse der hinter den Gefängnisstäben versammelten Mörder das vorbeigehende Mädchen.
Die Viten der Divine, alias Louis Culafroy, ihres Mignon, des jungen Triebtäters Notre-Dame-des-Fleurs, der Tunten von Montmartre und der wie ein Sternschnuppenschweif durch die Vorstellungswelt des Häftlings blitzenden Gestalten, ergeben einen Horizont radikal diesseitiger Heiligkeit. Keine Vergeistigung der Verbrechertat, keine blauen Blumen des Bösen, sondern eine alle und alles umfangende Heiligkeit, die versklavt - "Unterwerfung des Fleisches unter das Fleisch" - im langsamen, goldbeschwerten, weihrauchumwobenen Ritual einer um Gottvater gekappten Kirche. Die Welt der Kirche bleibt allgegenwärtig, spielt aber bloß die Rolle einer Wunderkiste, die mit Kandelabern, Emaillelilien, Altartüchern, Meßgewändern, Gesängen und Hostien im jungen Culafroy den Sinn fürs Ritual weckt. Schleicht der Junge sich dann jedoch in den Kirchenraum, um mit dem Niederwerfen des Hostienkelchs das Wunder zu provozieren, das apokalyptische Herabstürzen der Gipsstatuen aus ihren Nischen und das Zerreißen des Vorhangs, passiert nichts als Schweigen: Das Wunder ist, daß sich kein Wunder ereignet, "Gott hatte gekniffen. Gott war hohl. Nur ein Loch mit irgend etwas darum herum" - so hohl wie die Gipsbüste der Marie-Antoinette, von deren klaffender Leere der junge Erzähler buchstäblich verschluckt wurde, als ihr der Chignon abbrach.
Diese radikale Umdrehung der göttlichen Instanz ins Ich war es, was die Apologeten Genets seit Jean-Paul Sartre am meisten interessierte. Das schicksalhaft verstoßene Fürsorgekind entlaufe seinem Fatum durch den Sprung in eine radikale Freiheit, die weder marxistisch noch psychoanalytisch faßbar sei, schrieb Sartre in seiner Studie "Saint Genet" 1952. Genet schreibe nicht für andere Leser, sondern für Gott, also für sich allein, meinte Sartre und führte Genets Literatur so nachhaltig auf die falsche Fährte eines "masturbatorischen Schreibens". Diese neue Übersetzung mit den wiedereingefügten, gekennzeichneten Streichungen bezeugt nun noch einmal, wie irrig diese Auslegung war. Die gestrichenen Passagen mögen weitgehend pornographische Details betreffen, doch ergibt sich daraus keinerlei bisher verborgene Textperspektive, die nachträglich vertuscht worden wäre. Eine schlüssige Logik der Striche ist nicht erkennbar. Vielmehr dürften sie aufgrund einzelner Wünsche der Verlagslektoren oder Gönner entstanden sein, die Genet dann zum Anlaß einiger weiterer Retuschen nahm.
Besonders interessant in dieser Neuausgabe sind überdies die Ausführungen Armin Huttenlochers im Nachwort zum Hamburger Prozeß. Es ging um die Frage, ob ein allgemein zugängliches Kunstwerk auf seine Wirkung für ein normales oder ein besonders kundiges Publikum hin beurteilt werden soll. Zu Beginn des Genet-Prozesses 1960 herrschte ein breiter Konsens über den notwendigen Schutz des durchschnittlichen Moralempfindens, wie er dreißig Jahre früher im "Kunstprozeß" des Leipziger Reichsgerichts besiegelt worden war: Der gekreuzigte Christus mit Gasmaske und Soldatenstiefeln von George Grosz sei für ein gebildetes Publikum wohl ein anregendes Kunstwerk, für den einfachen Menschen aber möglicherweise ein unzumutbarer Affront, befand das Leipziger Urteil und hob ein gegenteiliges Urteil des Berliner Landgerichts auf. Diese Auffassung habe sich, so Huttenlochers These, in den frühen sechziger Jahren radikal geändert, unter anderem durch ein inzwischen gefälltes Urteil des Bundesgerichtshofs: Anläßlich eines in der Tübinger Studentenzeitschrift "prisma" veröffentlichten Gedichts hatte dieser das Prinzip der künstlerischen Freiheit in besonderer Weise den zeitgenössischen Werken zugesprochen.
Zu Genets "Notre-Dame-des-Fleurs" hatten der "Welt"-Literaturkritiker Willy Haas, der Feuilletonist Friedrich Sieburg und der Sexualforscher Hans Giese Gutachten verfaßt. Bei aller teilweise schroffen Distanzierung von der Person des Autors hoben sie übereinstimmend den literarischen Rang des Romans hervor. Für ein juristisches Kuriosum sorgte aber nicht zuletzt der literarisch gebildete Generalstaatsanwalt Ernst Buchholz mit seinem Plädoyer, der Antrag der Staatsanwaltschaft möge schließlich abgewiesen werden, was mit der Freigabe der Publikation im Juli 1962 auch geschah. An die vierzig Jahre hat diese ausgezeichnete Übersetzung nun gedient. In der eigenhändigen Feinüberarbeitung durch Hock selbst wird sie als erster der auf neun Bände angelegten Werkedition auch für die nächste, skandalfreie, künstlerisch kompromißlose Rezeptionsphase Genets maßgebend bleiben.
Jean Genet: "Notre-Dame-des-Fleurs." Werke in Einzelbänden, Teil I. Überarbeitete Übersetzung von Gerhard Hock. Mit einem Nachwort von Armin Huttenlocher. Merlin Verlag, Gifkendorf, 1998. 351 Seiten, geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.1999