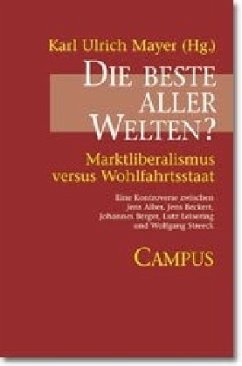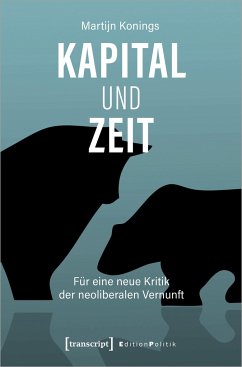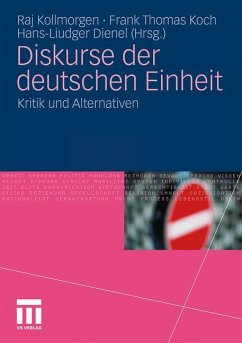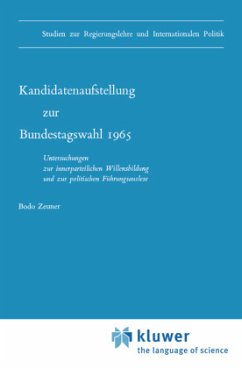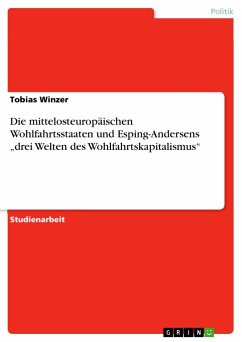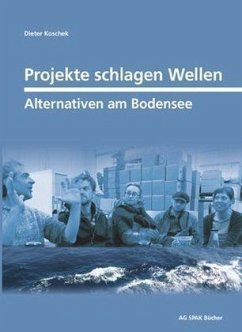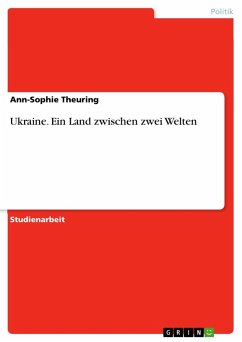Intellektuelle elektrisierenden Kapitalismuskritik sichtbar: Der Kapitalismus hat sich die Kritik gleichsam einverleibt und sich auf diese Weise in eine Vielfalt von Kapitalismen verwandelt. Damit verliert der Begriff "Spätkapitalismus" seine Endzeitlichkeit. Vielmehr fragt sich, unter welchen Umständen man welche Form aus den verschiedenen Welten des Kapitalismus vorziehen soll - schließlich gilt es einerseits, unerfreuliche Exemplare zu eliminieren, und andererseits, den Errungenschaften wie Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft zu einer erdumspannenden Geltung zu verhelfen.
So rücken denn auch die drei "K" moderner Gesellschaften in den Blickpunkt: Komplexität, Koordination, Kontrolle. Was tun, wenn in polyzentrischen Strukturen ohne übergeordnete Entscheidungsinstanz Koordination zur Mühsal und Steuerung zur Illusion wird? Die aktuelle Antwort heißt "Governance", allerdings viel weiter gefaßt, als dies beispielsweise bei den Spielarten der "Corporate Governance" für die verantwortungsvolle Leitung von Aktiengesellschaften der Fall ist. Vielmehr soll der Begriff Governance die Abkehr von kausalen Beziehungen hin zu Emergenz und die Erweiterung von bloßen Regelwerken hin zu kultureller Einbettung unterstreichen. Damit wird aber auch klar: Mit lockeren Diskussionsrunden oder ein paar Seminararbeiten ist diesem Thema nicht beizukommen. Und eine Konferenz? Die Skepsis angesichts einer solchen Vorstellung verfliegt, wenn man sich den "Welten des Kapitalismus" nähert. Max Miller (Universität Hamburg) gelingt es, die Ergebnisse der 2003 an der Hamburger Börse stattgefundenen Konferenz "Worlds of Capitalism" mit drei bereits anderswo erschienen Beiträgen und seiner eigenen inhaltsreichen Einführung in das Thema zu einem überaus anregenden Werk zu verbinden. Renommierte Wissenschaftler wie die Soziologen Johannes Berger, Steven Lukes und Claus Offe sowie die Ökonomen Harold Demsetz, Douglass North und Thomas Straubhaar tragen das Ihre dazu bei.
Natürlich geht es hier immer wieder um "Institutionen". Schließlich gebiert der junge Zweig des Neoinstitutionalismus laufend neue Erklärungsansätze. Egal, ob "rationalistisch" interpretiert, das heißt, auf externe Zwänge und Anreizsysteme beschränkt, oder "kulturalistisch" betrachtet und damit auch Sinnschichten, nicht hinterfragte Routinen und geteilte Überzeugungen umfassend - Institutionen zählen. Sie beeinflussen maßgeblich den technischen Fortschritt und erklären, warum manche Gesellschaften kreativer und damit wirtschaftlich leistungsfähiger sind als andere. Vielleicht muß man die Kausalkette aber auch umdrehen: Reiche Ökonomien können sich einfach bessere Institutionen leisten und erhöhen so ihren Reichtum weiter. Gleichwohl wäre es falsch, nationale Ökonomien auf bestimmte Entwicklungspfade festzulegen. Institutionen lassen sich vielmehr zu verschiedenen Governance-Logiken verknüpfen - Markt, Hierarchie, Verbände, Gemeinschaft, Netzwerk, Staat - aus denen innovative Mischformen entstehen, die wiederum den Nährboden für neue "Kapitalismen" bilden.
Sozialistischen Planwirtschaften fehlt ein solcher Humus, sie sterben ab. Sie scheitern auch an der naiven Vorstellung von einer berechenbaren Welt, weil sie das Phänomen der Pfadabhängigkeit ignorieren: "Unsere Wahlhandlungen in der Gegenwart sind an das gebunden, was geschehen ist, und damit an die Regeln und Normen, die aus der Vergangenheit stammen", schreibt der Nobelpreisträger Douglass North in seinem Beitrag, der in gewohnter Weise die Grenzen der reinen Ökonomie weit hinter sich läßt. Was wir dennoch tun können, ist, die Menge wählbarer Optionen und den Raum für Experimente und Veränderungen möglichst groß zu halten. Das ist es letztlich, was dem Kapitalismus seine Überlebensfähigkeit zu sichern scheint. Die verschiedenen Welten des Kapitalismus haben allerdings etwas Invasives an sich. In Gestalt des Marktes dringen sie in Bereiche ein, die bislang der Gemeinschaft vorbehalten waren, so der Tenor am Schluß des Buches. Der Marxsche "Warenfetischismus" trete nun als "Warenförmigkeit" oder "Kommodifizierung" wieder auf den Plan. Und die Idee des Marktversagens werde uminterpretiert in das Bestreben, auch die letzten Nichtmärkte in Märkte zu verwandeln und Güter ohne Warencharakter endlich zu solchen zu machen.
HEINZ K. STAHL.
Max Miller (Herausgeber): Welten des Kapitalismus. Institutionelle Alternativen in der globalisierten Ökonomie. Campus-Verlag, Frankfurt 2005, 388 Seiten, 32,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
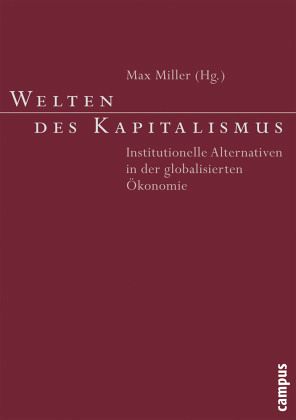





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.08.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.08.2006