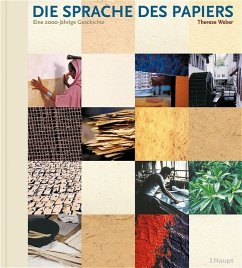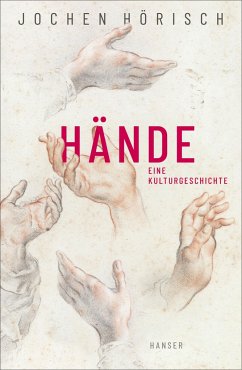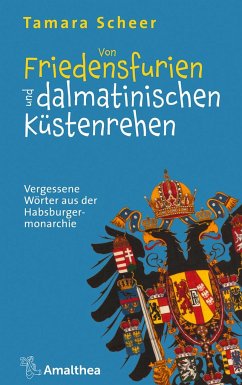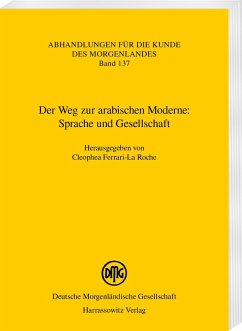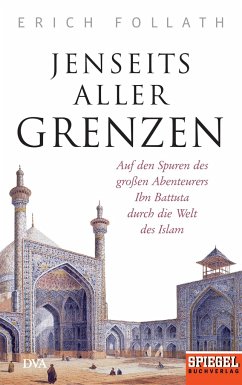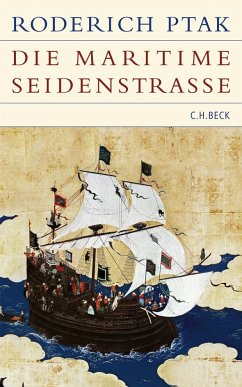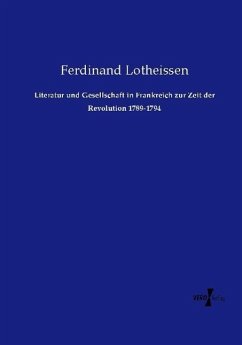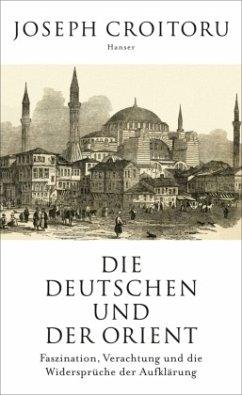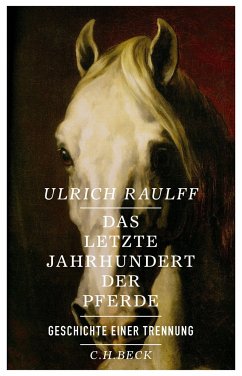Weiße Magie
Die Epoche des Papiers
Versandkostenfrei!
Versandfertig in ca. 2 Wochen
24,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Man kann darauf drucken und schreiben, man kann es zerreißen, knicken und falten: Papier ist eine magische Substanz, die wie keine andere zur Entwicklung der modernen Welt beigetragen hat. Als Wechsel und Papiergeld war es unentbehrlich für die Ökonomie. Als Briefpapier wurde es zum Schauplatz der modernen Seele, als Zeitungspapier zum Schauplatz der Politik. Lothar Müller erzählt, wie das aus China stammende Papier von Ägypten nach Europa kam und zum Grundstoff der modernen Zivilisation wurde. Seine Kronzeugin ist die Literatur von Rabelais und Grimmelshausen, von James Joyce bis Paul V...
Man kann darauf drucken und schreiben, man kann es zerreißen, knicken und falten: Papier ist eine magische Substanz, die wie keine andere zur Entwicklung der modernen Welt beigetragen hat. Als Wechsel und Papiergeld war es unentbehrlich für die Ökonomie. Als Briefpapier wurde es zum Schauplatz der modernen Seele, als Zeitungspapier zum Schauplatz der Politik. Lothar Müller erzählt, wie das aus China stammende Papier von Ägypten nach Europa kam und zum Grundstoff der modernen Zivilisation wurde. Seine Kronzeugin ist die Literatur von Rabelais und Grimmelshausen, von James Joyce bis Paul Valéry. Wir glauben das "Gutenberg-Zeitalter" zu kennen. Aber wir verstehen es besser, wenn wir seine Hintergrundwelt entdecken: die Epoche des Papiers.