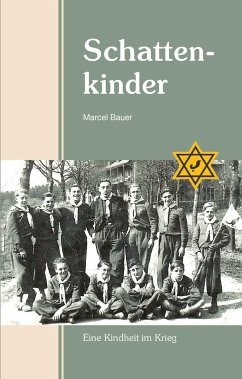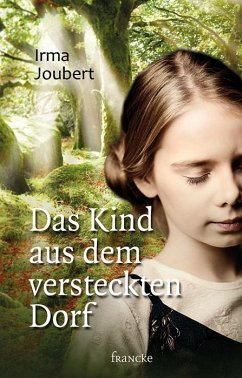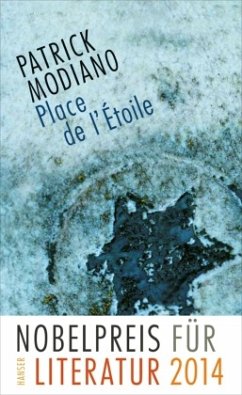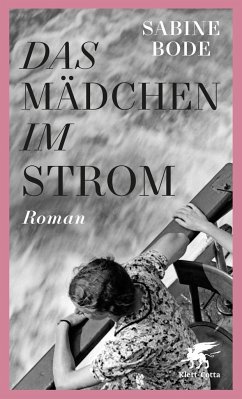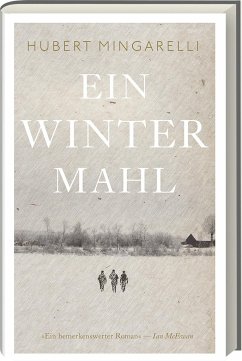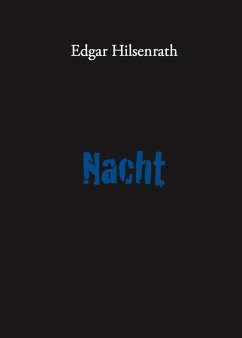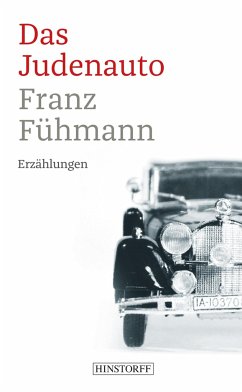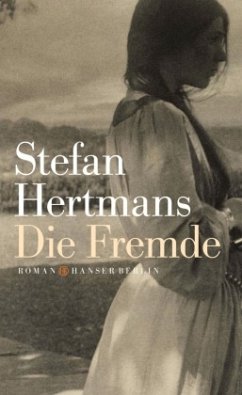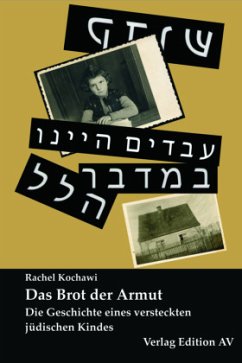schmutzig, die andere in Unschuld gewaschen - so stellt er sich vor, der Kollaborateur.
Der Roman trägt im Deutschen den durchgestrichenen Titel "Weil der Mensch erbärmlich ist". Das ist doppelt plakativ, entspricht aber dem Grundzug der Darstellung: der Ambivalenz. Im Original heißt das Buch einfach "Wil", nach der Hauptfigur Wilfried Wils, einem jungen Mann von gerade zwanzig Jahren, der sich 1941, nach dem Einmarsch der Deutschen in seiner Heimatstadt Antwerpen, zur belgischen Hilfspolizei meldet. Seine Motivation ist von einem jener existentiellen Widersprüche gekennzeichnet, wie sie der Krieg mit sich bringt: "Junger Kerl wird Polizist, um nicht als Fremdarbeiter nach Deutschland abtransportiert zu werden, und hilft als Bulle dabei, Leute festzunehmen, die versuchen, ebendiesem Arbeitsdienst zu entgehen."
Das besetzte Antwerpen ist voll von Deutschen "und solchen, die am liebsten Deutsche wären", wie Wilfrieds ehemaliger Klassenkamerad Karel, ein Musterschüler, der sich nun in einen "Herrenmenschen" verwandelt und zur Waffen-SS geht. Als der Nationalsozialismus für einige Jahre zur dominierenden Macht in Europa wurde, war das gerade in den besiegten Ländern mit einem Zugewinn an ideologischer Attraktion verbunden. Diejenigen, die noch zögern mit ihrer Zustimmung, werden belächelt: "Diese Leute nannte man damals ,Attentisten', als seien sie in der Vorkriegsperiode stecken geblieben." Wils ist ein Abwartender und Skeptiker von Natur, er beschäftigt sich lieber mit Literatur als mit Politik. Er wird später eine Neben-Karriere als Dichter absolvieren, auch wenn er hauptberuflich im Polizeidienst hängenbleibt.
Gleich auf den ersten Seiten trifft dieser Hilfspolizist mit seinem Kollegen Lode auf eine Gruppe deutscher Feldgendarmen: "Mitkommen!" Die beiden sollen den Ortsunkundigen helfen, eine jüdische Familie "abzuholen". Wilfried spürt die Verzweiflung dieser Familie. Innerlich distanziert er sich aber von ihr mit abschätzigen Formulierungen wie "müffelnde Bande" - auch in Antwerpen grassiert der Antisemitismus, man spottet über die "Diamantenhändler", denen es "endlich" an den Kragen gehe. Als eines der jüdischen Kinder hinfällt und von einem Deutschen geschlagen wird, geht Wilfrieds Freund dazwischen. Woraufhin ein Deutscher mit seinem Knüppel auf Lode einschlagen will. Wilfried fällt ihm, ohne zu zögern, in den Arm. Der Deutsche ist so verblüfft, dass er nicht reagiert; er kann "einfach nicht glauben, dass ihm das tatsächlich passiert, in diesem lächerlichen Land, welches sie fast mühelos besetzt haben". Dies ist eine wie in Zeitlupe geschilderte Szene voller Ambivalenzen. Wilfried ist in einem Moment angstgetrieben oder gar verächtlich, beweist jedoch im nächsten selbstvergessenen Mut.
Wie erklärt man einem Nachgeborenen, der aus sicherer Distanz seine moralisierenden Urteile fällt, "wozu der Mensch in der Lage sein kann" und was es heißt, "den Dreckskerl in sich selbst zu spüren"? Dieser innere Dreckskerl macht sich wieder bemerkbar, als Monate später größere Abtransporte von Juden abzusichern sind. "Wir riegeln die Straßen ab und halten Wache, als fände hier in Kürze ein sportliches Großereignis statt." Als die Hilfspolizisten dann auch Deportationen in Eigenregie durchführen sollen, erwägen sie kurz, den Dienst zu verweigern. Aber die Furcht vor dem Gestapo-Lager Breendonk ist stärker.
"Das gefügige Belgien" lautet der Titel einer historischen Studie über die Jahre der Besatzung und die Mitwirkung der Begier bei den Deportationen. Nicht alle waren gefügig: 30 000 Juden wurden von belgischen Familien versteckt. Auch Wilfrieds Freund und zukünftiger Schwager Lode, dieser menschenfreundliche Metzgerssohn, weiht ihn eines Tages in ein lebensgefährliches Geheimnis ein: Die Familie habe einen Juden versteckt. Wilfried ist schockiert - darüber, dass man ihm vertraut, ihn für einen "guten" Menschen hält. Er wird eingeteilt zum Versorgungsdienst und bringt dem versteckten Mann nun regelmäßig Nahrungsmittel und Bücher.
Wilfrieds Verflechtungen nach allen Seiten hin sind hoch riskant. Und es ist schwer zu erkennen, welches Spiel selbst diejenigen spielen, die man zu kennen glaubt. Irgendwann gerät er in den Ruf des Verräters und "Judenfreundes". Um dem entgegenzuwirken, liefert er einem der Judenverfolger die Idee für noch drastischere Maßnahmen; aus einem Scherz wird blutiger Ernst. Nie hat Wilfried sich erbärmlicher gefühlt. Und selten hat man einen Roman gelesen, der solche moralischen Zwangslagen und solche Mehrfachfrakturen aller geraden, einfachen Gefühle eindringlicher dargestellt hat.
Zum Reiz des Buchs gehört es, dass die Handlung einbettet ist in die Alltagsbeschreibungen des Lebens unter der Besatzung: Kneipenabende, Tanzveranstaltungen, Sonntagsbesuche bei den Eltern der Freundin, der Schwester Lodes. Langsam, aber mächtig erwacht bei Wilfried die Sexualität. Es ist eben auch eine Coming-of-Age-Geschichte unter historisch erschwerten Bedingungen. Jeroen Olyslaegers, Jahrgang 1967, hat auch Theaterstücke verfasst. Das merkt man seinem Roman an. Es ist ein - im besten Sinne - theatralischer Monolog des Ich-Erzählers Wilfried, gerichtet an einen Urenkel, den es womöglich gar nicht gibt, geschrieben in einem auch in der deutschen Übersetzung vorzüglich getroffenen Ton angriffslustiger Selbstverteidigung, zugleich auch von einer Wahrhaftigkeit und bissigen Ironie gekennzeichnet, die alle Selbstgerechtigkeit unterläuft. Bisweilen erscheint die Konstruktion etwas unübersichtlich und forciert (nicht sehr plausibel, dass ein hinfälliger Greis solch einen bissigen Stil schreibt), aber sie bringt eine Dynamik der Schuld in die Beichte, die sich weniger aus dem schlechten Gewissen des halbherzigen Kollaborateurs begründet als aus den untergründigen Nachwirkungen seines Handelns.
WOLFGANG SCHNEIDER
Jeroen Olyslaegers:
"Weil der Mensch
erbärmlich ist". Roman.
Aus dem Niederländischen von Isabel Hessel und
Gregor Seferens. DuMont Buchverlag , Köln 2018. 370 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
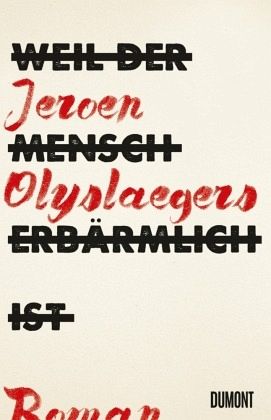





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2019