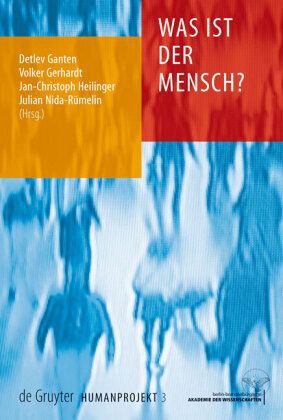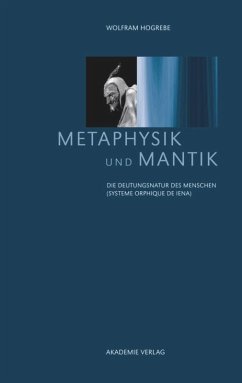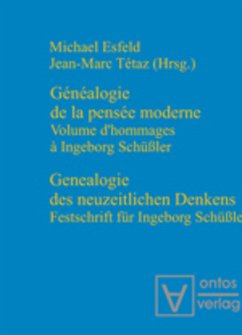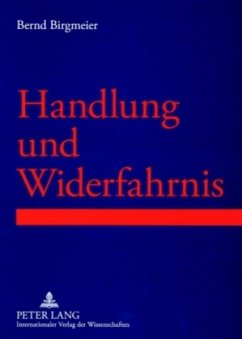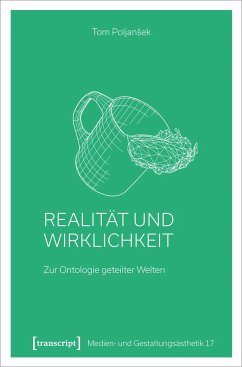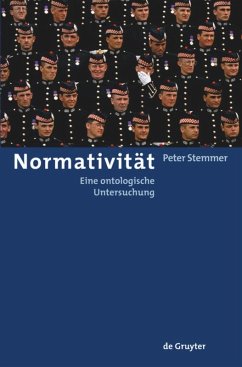Was ist der Mensch?
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Die Frage des Menschen nach sich selbst beschäftigt Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten, so auch in der Gegenwart. Die hier versammelten Wissenschaftler, Politiker, Theologen, Journalisten und Schriftsteller aus verschiedenen kulturellen Traditionen geben in über fünfzig prägnanten Beiträgen ihre persönliche Antwort auf die aufgeworfene Frage. Was ist davon zu erwarten? Sicherlich keine abschließende Lösung der Frage. Doch ist ein schillerndes Spektrum aktueller Positionen zum menschlichen Selbstverständnis entstanden - zugleich kritisch und konstruktiv, pointiert und tiefgrü...
Die Frage des Menschen nach sich selbst beschäftigt Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten, so auch in der Gegenwart. Die hier versammelten Wissenschaftler, Politiker, Theologen, Journalisten und Schriftsteller aus verschiedenen kulturellen Traditionen geben in über fünfzig prägnanten Beiträgen ihre persönliche Antwort auf die aufgeworfene Frage. Was ist davon zu erwarten? Sicherlich keine abschließende Lösung der Frage. Doch ist ein schillerndes Spektrum aktueller Positionen zum menschlichen Selbstverständnis entstanden - zugleich kritisch und konstruktiv, pointiert und tiefgründig.
Eingeleitet und kommentiert wird die Sammlung mit Beiträgen von Volker Gerhardt, Julian Nida-Rümelin, Detlev Ganten und Jan-Christoph Heilinger.
Eingeleitet und kommentiert wird die Sammlung mit Beiträgen von Volker Gerhardt, Julian Nida-Rümelin, Detlev Ganten und Jan-Christoph Heilinger.
Detlef Ganten, Charité-Universitätsmedizin Berlin; Volker Gerhardt und Jan-Christoph Heilinger, Humboldt-Universität zu Berlin; Julian Nida-Rümelin, Ludwig-Maximilians-Universität München.
Produktdetails
- Humanprojekt 3
- Verlag: De Gruyter
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 304
- Erscheinungstermin: 28. August 2008
- Deutsch, Englisch
- Abmessung: 230mm x 155mm x 17mm
- Gewicht: 454g
- ISBN-13: 9783110202625
- ISBN-10: 311020262X
- Artikelnr.: 23876313
Herstellerkennzeichnung
Walter de Gruyter
Genthiner Straße 13
10785 Berlin
productsafety@degruyterbrill.com
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008Lust auf Selbstdemütigung
Eine Expertenrunde fragt: Was ist der Mensch? / Von Michael Pawlik
Nach einem Wort Schellings schlägt im Menschen die Natur die Augen auf und schaut sich an. Der Mensch verfügt über eine Fähigkeit, die allen anderen Lebewesen abgeht. Er vermag sich Gegenständen seiner Wahl, nicht zuletzt auch sich selbst, in objektiv-distanzierter Manier zuzuwenden und sie als Repräsentanten allgemeiner Figurationen zu begreifen. Dank dieser Fähigkeit weiß der Mensch, dass er ein Lebewesen ist wie alle anderen auch, ein Säugetier, dessen Physiologie und Verhalten durch denselben Evolutionsprozess geprägt worden sind, der alles Leben hervorgebracht hat. Er weiß freilich auch, dass er zu dieser Einsicht nur
Eine Expertenrunde fragt: Was ist der Mensch? / Von Michael Pawlik
Nach einem Wort Schellings schlägt im Menschen die Natur die Augen auf und schaut sich an. Der Mensch verfügt über eine Fähigkeit, die allen anderen Lebewesen abgeht. Er vermag sich Gegenständen seiner Wahl, nicht zuletzt auch sich selbst, in objektiv-distanzierter Manier zuzuwenden und sie als Repräsentanten allgemeiner Figurationen zu begreifen. Dank dieser Fähigkeit weiß der Mensch, dass er ein Lebewesen ist wie alle anderen auch, ein Säugetier, dessen Physiologie und Verhalten durch denselben Evolutionsprozess geprägt worden sind, der alles Leben hervorgebracht hat. Er weiß freilich auch, dass er zu dieser Einsicht nur
Mehr anzeigen
gelangen konnte, weil er ein unheilbarer Sinnsucher und Sinnsetzer ist, ein mit Hilfe von Zeichen denkendes und sich mit anderen verständigendes animal symbolicum, ein von Natur aus künstliches Geschöpf.
Die philosophische Anthropologie, der diese Formeln entstammen, hatte über geraume Zeit eine schlechte Presse. Sie galt als anachronistisches Rettungsunternehmen für die traditionellen Deutungen des Menschen angesichts der darwinistischen Bedrohung, als letzter und zum Scheitern verurteilter Versuch, die eigene Spezies aus der Tierreihe, aus der sie entstanden war, sozusagen wieder hinauszudefinieren. In der heutigen Diskussion über die Bestimmung des Menschen ist von solchen Vorbehalten kaum noch etwas zu spüren. Der aus dem "Humanprojekt" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hervorgegangene Sammelband "Was ist der Mensch?" lehrt, dass selbst Autoren, die mit allen Wassern der modernen Evolutionstheorie gewaschen sind, der Sache nach nichts wesentlich anderes sagen als Plessner oder Cassirer.
Der Mensch, so wird allenthalben betont, sei nicht nur ganz Tier, sondern auch ganz Kulturwesen. Die allgemeinen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns, Ergebnis der biologischen Evolution, hätten den Menschen seit rund hunderttausend Jahren freigesetzt in die Eigendynamik der Kulturgeschichte, die vermöge des Wechselspiels von Tradition und Innovation die Weitergabe und Fortentwicklung eines immensen, nicht genetisch gebundenen Erfahrungsschatzes ermöglicht habe (Alfred Gierer, Michael Fischer, Matthias Jung, Wolfgang Welsch). "Spezialisierungen in einer bestimmten Leistung finden wir auch bei anderen Spezies. Doch Kultur in Verbindung mit der Sprache scheint das einzige Beispiel für eine Spezialisierung und große Entfaltung ohne direkte genetische Fixierung zu sein" (Andreas Elepfandt).
Aber hängt, Kultur hin oder her, der Mensch nicht letztlich doch an der Leine der biologischen Evolution und ihrer Gesetzmäßigkeiten? Ist er nicht stets, selbst wenn er die "Kunst der Fuge" schreibt oder in nibelungenhafter Vertragstreue dreihundert Millionen Euro an einen insolventen Geschäftspartner überweist, nur "Exekutor biologischer Programme", welche ihrerseits nur ein einziges Ziel verfolgen, nämlich ihren eigenen Erhalt?
Ein solcher militant-reduktionistischer Naturalismus, begünstigt durch die heutige Prädominanz der Naturwissenschaften und eine geradezu masochistisch anmutende gesellschaftliche Lust an der Selbstdemütigung, darf selbstverständlich im vorliegenden Band nicht fehlen (Eckart Voland). Er wird jedoch fast einhellig zurückgewiesen. Nicht nur, so wird ihm entgegengehalten, habe die Forschung die Mär vom "egoistischen Gen" schon seit längerem widerlegt: "Gene sind nicht ,egoistisch', sondern Kommunikatoren und Kooperatoren."
Vor allem seien Erleben und Verhalten des menschlichen Organismus mehrere Systemebenen oberhalb dessen angesiedelt, was den Menschen mit Blick auf die Arbeitsweise und Funktion seiner Gene ausmache. "Ein von der Biologie her auf den Menschen - als ein erlebender und sich verhaltender Gesamtorganismus - gerichteter Blick bedarf einer Perspektive, die über die Gene hinausweist" (Joachim Bauer).
Mit der die menschliche Existenz kennzeichnenden "Transformation biologischer Naturgeschichte in Sozial- und Kulturgeschichte" (Dieter Sturma) wird freilich einem "naiven Biologismus" nicht einfach ein "bornierter Kulturalismus" entgegengesetzt (Jürgen Mittelstraß). Dass die Ergebnisse der biologischen Evolution den Spielraum möglicher kultureller Entwicklung und Differenzierung beschränken, ist für alle Autoren selbstverständlich. Gemeinsinn und Opferbereitschaft werden allen Bemühungen der Linkspartei zum Trotz immer knappe und entsprechend pfleglich zu behandelnde gesellschaftliche Güter bleiben. Aber, und dies ist das Entscheidende, die menschliche Kultur bringt Praktiken und Begründungsstrategien hervor, die sich einer Verrechnung in naturalistischen Kategorien entziehen. Einen der entscheidenden Einschnitte in der Entwicklung zur humanen Lebensform stellt die Entstehung der Fähigkeit dar, das eigene Verhalten an Gründen auszurichten (Sturma). Als "Tier, das seine eigenen Gründe hat", erhebt der handelnde Mensch einerseits den Anspruch auf Selbstbestimmung. Mit der stillschweigend erklärten Bereitschaft, über die Validität dieser Gründe gegebenenfalls Rechenschaft abzulegen, erkennt er andererseits seine Begründungspflichtigkeit gegenüber der Öffentlichkeit an (Volker Gerhardt). Wie das Verhältnis zwischen Individuum und Allgemeinheit genau zu denken sei, gehört seit Platon zu den großen Fragen der Philosophie. Aber in dieser Diskussion das untergründige Bestreben nach genetischer Optimierung am Werk zu sehen, erscheint geradezu absurd. Mit der Semantik von Freiheit und Pflicht ist etwas Neues in die Welt gekommen, von dem die Natur nichts weiß.
Den Sinn für dieses Neue wach zu halten - man mag es Kultur nennen, Gesellschaft oder auch Freiheit -, darin besteht, wie die Beiträge des vorliegenden Bandes eindrucksvoll deutlich machen, die Funktion des Begriffs Mensch. An dieser Stelle trennen sich die Wege der modernen und der älteren philosophischen Anthropologie. Der Rede vom Menschen wird heute nur noch die Rolle eines Erinnerungspostens zugestanden, nicht mehr die eines belastbaren theoretischen Grundbegriffs. "Die Humanwissenschaften haben spezifischere Erkenntnisinteressen und Explananda" (Geert Keil).
In ihnen wird der Mensch, wie der Philosoph Herbert Schnädelbach einmal sagte, zum Epiphänomen des anderweitig viel zuverlässiger Erforschten. Genauso hat dies bereits Kant gesehen. Zwar hat er gelegentlich bemerkt, die drei Grundfragen der Philosophie - "Was kann ich wissen?", "Was soll ich tun?" und "Was darf ich hoffen?" - ließen sich zu einer einzigen zusammenfassen: "Was ist der Mensch?" Jedoch hat er sich gehütet, daraus irgendwelche systematischen Konsequenzen zu ziehen. Der Mensch ist das Ungreifbare, der Überschuss, die Restmenge, die mahnend stehenbleibt, auch wenn alle Gleichungen gelöst zu sein scheinen. Lässt sich Größeres über ihn sagen?
Detlev Ganten, Volker Gerhardt, Jan-Christoph Heilinger, Julian Nida-Rümelin (Hrsg.): "Was ist der Mensch?" Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2008. 292 S., br., 10,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Die philosophische Anthropologie, der diese Formeln entstammen, hatte über geraume Zeit eine schlechte Presse. Sie galt als anachronistisches Rettungsunternehmen für die traditionellen Deutungen des Menschen angesichts der darwinistischen Bedrohung, als letzter und zum Scheitern verurteilter Versuch, die eigene Spezies aus der Tierreihe, aus der sie entstanden war, sozusagen wieder hinauszudefinieren. In der heutigen Diskussion über die Bestimmung des Menschen ist von solchen Vorbehalten kaum noch etwas zu spüren. Der aus dem "Humanprojekt" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hervorgegangene Sammelband "Was ist der Mensch?" lehrt, dass selbst Autoren, die mit allen Wassern der modernen Evolutionstheorie gewaschen sind, der Sache nach nichts wesentlich anderes sagen als Plessner oder Cassirer.
Der Mensch, so wird allenthalben betont, sei nicht nur ganz Tier, sondern auch ganz Kulturwesen. Die allgemeinen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns, Ergebnis der biologischen Evolution, hätten den Menschen seit rund hunderttausend Jahren freigesetzt in die Eigendynamik der Kulturgeschichte, die vermöge des Wechselspiels von Tradition und Innovation die Weitergabe und Fortentwicklung eines immensen, nicht genetisch gebundenen Erfahrungsschatzes ermöglicht habe (Alfred Gierer, Michael Fischer, Matthias Jung, Wolfgang Welsch). "Spezialisierungen in einer bestimmten Leistung finden wir auch bei anderen Spezies. Doch Kultur in Verbindung mit der Sprache scheint das einzige Beispiel für eine Spezialisierung und große Entfaltung ohne direkte genetische Fixierung zu sein" (Andreas Elepfandt).
Aber hängt, Kultur hin oder her, der Mensch nicht letztlich doch an der Leine der biologischen Evolution und ihrer Gesetzmäßigkeiten? Ist er nicht stets, selbst wenn er die "Kunst der Fuge" schreibt oder in nibelungenhafter Vertragstreue dreihundert Millionen Euro an einen insolventen Geschäftspartner überweist, nur "Exekutor biologischer Programme", welche ihrerseits nur ein einziges Ziel verfolgen, nämlich ihren eigenen Erhalt?
Ein solcher militant-reduktionistischer Naturalismus, begünstigt durch die heutige Prädominanz der Naturwissenschaften und eine geradezu masochistisch anmutende gesellschaftliche Lust an der Selbstdemütigung, darf selbstverständlich im vorliegenden Band nicht fehlen (Eckart Voland). Er wird jedoch fast einhellig zurückgewiesen. Nicht nur, so wird ihm entgegengehalten, habe die Forschung die Mär vom "egoistischen Gen" schon seit längerem widerlegt: "Gene sind nicht ,egoistisch', sondern Kommunikatoren und Kooperatoren."
Vor allem seien Erleben und Verhalten des menschlichen Organismus mehrere Systemebenen oberhalb dessen angesiedelt, was den Menschen mit Blick auf die Arbeitsweise und Funktion seiner Gene ausmache. "Ein von der Biologie her auf den Menschen - als ein erlebender und sich verhaltender Gesamtorganismus - gerichteter Blick bedarf einer Perspektive, die über die Gene hinausweist" (Joachim Bauer).
Mit der die menschliche Existenz kennzeichnenden "Transformation biologischer Naturgeschichte in Sozial- und Kulturgeschichte" (Dieter Sturma) wird freilich einem "naiven Biologismus" nicht einfach ein "bornierter Kulturalismus" entgegengesetzt (Jürgen Mittelstraß). Dass die Ergebnisse der biologischen Evolution den Spielraum möglicher kultureller Entwicklung und Differenzierung beschränken, ist für alle Autoren selbstverständlich. Gemeinsinn und Opferbereitschaft werden allen Bemühungen der Linkspartei zum Trotz immer knappe und entsprechend pfleglich zu behandelnde gesellschaftliche Güter bleiben. Aber, und dies ist das Entscheidende, die menschliche Kultur bringt Praktiken und Begründungsstrategien hervor, die sich einer Verrechnung in naturalistischen Kategorien entziehen. Einen der entscheidenden Einschnitte in der Entwicklung zur humanen Lebensform stellt die Entstehung der Fähigkeit dar, das eigene Verhalten an Gründen auszurichten (Sturma). Als "Tier, das seine eigenen Gründe hat", erhebt der handelnde Mensch einerseits den Anspruch auf Selbstbestimmung. Mit der stillschweigend erklärten Bereitschaft, über die Validität dieser Gründe gegebenenfalls Rechenschaft abzulegen, erkennt er andererseits seine Begründungspflichtigkeit gegenüber der Öffentlichkeit an (Volker Gerhardt). Wie das Verhältnis zwischen Individuum und Allgemeinheit genau zu denken sei, gehört seit Platon zu den großen Fragen der Philosophie. Aber in dieser Diskussion das untergründige Bestreben nach genetischer Optimierung am Werk zu sehen, erscheint geradezu absurd. Mit der Semantik von Freiheit und Pflicht ist etwas Neues in die Welt gekommen, von dem die Natur nichts weiß.
Den Sinn für dieses Neue wach zu halten - man mag es Kultur nennen, Gesellschaft oder auch Freiheit -, darin besteht, wie die Beiträge des vorliegenden Bandes eindrucksvoll deutlich machen, die Funktion des Begriffs Mensch. An dieser Stelle trennen sich die Wege der modernen und der älteren philosophischen Anthropologie. Der Rede vom Menschen wird heute nur noch die Rolle eines Erinnerungspostens zugestanden, nicht mehr die eines belastbaren theoretischen Grundbegriffs. "Die Humanwissenschaften haben spezifischere Erkenntnisinteressen und Explananda" (Geert Keil).
In ihnen wird der Mensch, wie der Philosoph Herbert Schnädelbach einmal sagte, zum Epiphänomen des anderweitig viel zuverlässiger Erforschten. Genauso hat dies bereits Kant gesehen. Zwar hat er gelegentlich bemerkt, die drei Grundfragen der Philosophie - "Was kann ich wissen?", "Was soll ich tun?" und "Was darf ich hoffen?" - ließen sich zu einer einzigen zusammenfassen: "Was ist der Mensch?" Jedoch hat er sich gehütet, daraus irgendwelche systematischen Konsequenzen zu ziehen. Der Mensch ist das Ungreifbare, der Überschuss, die Restmenge, die mahnend stehenbleibt, auch wenn alle Gleichungen gelöst zu sein scheinen. Lässt sich Größeres über ihn sagen?
Detlev Ganten, Volker Gerhardt, Jan-Christoph Heilinger, Julian Nida-Rümelin (Hrsg.): "Was ist der Mensch?" Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2008. 292 S., br., 10,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ist er nur ein höher entwickeltes Tier, der Mensch, oder ist er etwas anderes oder mehr? Diese Frage der philosophischen (und sonstigen) Anthropologie wird in diesem Sammelband von kompetenter Seite beantwortet. Zur ersteren Option tendiert im erlauchten Beiträgerkreis freilich kaum einer mehr, wie der Rezensent Michael Pawlik feststellt als prominente Ausnahme kann er nur den "militant-reduktionistischen Naturalismus" Eckart Volands ausmachen. Der Rest der Autoren hält es viel eher mit um evolutionstheoretische Aufklärung erweiterten Positionen a la Plessner oder Cassirer. Soll heißen: Der Mensch wird als Kulturwesen Mensch, weil er in der Kultur etwas schafft, das in der Natur so keine Präzedenz hat. Ein Reich nämlich, in dem die Rede von "Freiheit und Pflicht" einzig Sinn hat. Die Emphase, das macht der Band für Pawlik auch klar, liegt dabei nicht auf der Pathosformel "Mensch" selbst, die vor allem als "Erinnerungsposten" fungiert für das Neue, das mit Symbol und Kultur in die Welt kam.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Forschungsreise zu sich selbst."
Hans-Joachim Rennkamp in: Christ in der Gegenwart 1/2009
Hans-Joachim Rennkamp in: Christ in der Gegenwart 1/2009
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für