organisierten Karnevals im Rheinland. Noch für die Karnevalssaison 1823 wurde beschlossen, am Fastnachtsmontag - der Begriff Rosenmontag bürgerte sich erst ab 1831 ein - einen Maskenumzug durch die Stadt zu organisieren. In nur wenigen Jahren bildete sich mit Karnevalssitzungen, dem Maskenumzug und einem großen Maskenball jene Festkultur und -struktur heraus, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Das Kölner Modell gewann schnell an Popularität, so daß andere Karnevalshochburgen nachzogen. Neidisch blickten die Düsseldorfer auf die immer zahlreicher nach Köln strömenden Schaulustigen und nahmen 1825 die Reform ihres Karnevals in Angriff.
Zwei Bücher haben sich jüngst der Geschichte des rheinischen Karnevals angenommen. Beide Autorinnen leisteten Kärnerarbeit, durchforsteten Archive, lasen sich durch apologetische Festschriften der Karnevalsgesellschaften, blickten mit den Augen preußischer Polizeispitzel auf die Karnevalsvereine und werteten Tagebücher, Karnevalszeitungen sowie weitere schriftliche Quellen aus. Die inhaltlichen Erkenntnisse sind für die Zeit bis 1914 im wesentlichen gleich, die Präsentation der Ergebnisse unterschiedlich. Christina Frohn legte mit "Der organisierte Narr" eine detailreiche Spezialstudie für Köln, Düsseldorf und Aachen in der Zeit von 1823 bis 1914 vor. Hildegard Brogs Buch "Was auch passiert: D'r Zoch kütt!" präsentiert für das breite Publikum eine Überblicksdarstellung von den frühneuzeitlichen Anfängen bis zur Gegenwart. Beide Bücher sind überzeugend mit Abbildungen ausgestattet, was gerade im Fall der Dissertation von Frohn hervorgehoben werden muß.
Der Verbindung von Politik und Karneval wird in beiden Werken großes Gewicht beigemessen. Die Jahre vor der Revolution von 1848 entwickelten sich dabei zu Sternstunden des Karnevals. Die Karnevalsgesellschaften fungierten vor allem in Köln und Düsseldorf als Parteienersatz, waren von liberalem und demokratischem Gedankengut durchdrungen, und mancher Paulskirchenabgeordnete sammelte seine rhetorischen Fähigkeiten in der Bütt. Daß die Revolution in Köln an den Fastnachtstagen des Jahres 1848 ihren Ausgangspunkt hatte, war allerdings reiner Zufall. Vor allem Christina Frohn weist in ihrer Studie nach, daß es vor allem ein Nebeneinander der beiden Bewegungen war. Hildegard Brog ist bei der Relativierung dieser karnevalistischen Heldengeschichte um Nuancen zurückhaltender.
Der weitere Verlauf der Karnevalsentwicklung wird von beiden gleich bewertet. Seit der Reichseinigung im Jahr 1871 nahmen die Rosenmontagsumzüge, die Festzeitungen und Büttenreden in ihrem politischen Gehalt immer deutlicher nationalistische Töne an. Die den Preußen nach 1815 nicht gerade wohlgesonnenen Rheinländer hatten in ihren Karnevalsgesellschaften nach 1890 keine Bedenken mehr, Kaiser Wilhelm II. zu huldigen. Bei beiden Autorinnen ist die Tendenz vorhanden, vor allem nach einer kritischen Haltung unter den Karnevalisten und dem Verbleib demokratisch-liberaler Traditionen zu suchen. Auf die Idee, ihre Fragestellung um 180 Grad zu wenden und nach den Wurzeln dieser staatstragenden Ideen zu suchen, kommen sie beide nicht. Dabei analysieren sie klar als Trägerschicht die lokale Elite, ab den 1840er und 1850er Jahren die städtische Mittelschicht heraus.
Christina Frohn blickt bei diesem Themenkomplex intensiver auf das Binnenleben der Vereine, das Cliquenwesen und die Verbindungslinie zwischen städtischer Gesellschaft und den Karnevalsgesellschaften. In der Dichte ihrer Darstellung bleibt sie allerdings weit von Emmanuel Le Roy Laduries Buch entfernt, der um den Karneval in Romans 1579/80 eine brillante Sozial-, Kultur- und Politikgeschichte der südfranzösischen Stadt vorlegte. Dennoch werden die entscheidenden Fragen nach der "sozialdisziplinierenden" Wirkung der Karnevalsvereine, der zunehmenden sozialen Ausdifferenzierung, der (spieß-)bürgerlichen Angst vor allem Unkontrollierten, allem "Unsittlichen" gestellt und beantwortet. Obwohl der Karneval durch die Festkomitees gezähmt wurde, sah der Staat hinter jedem Maskierten einen potentiellen Revolutionär. Zensurbestimmungen, Polizeiverordnungen, Maskierungsverbote durchzogen die Geschichte genauso wie der Rosenmontagszug die Kölner Innenstadt.
In Hildegard Brogs Buch läßt sich dieses Themenfeld auch für die Zeit des Nationalsozialismus weiter verfolgen. Entgegen den Behauptungen ehemaliger Karnevalsveteranen konnte von einem Widerstand keine Rede sein. Zwar hatten sich die Kölner Karnevalsgesellschaften dem Griff nach einer völligen organisatorischen Gleichschaltung mit einer mutigen Denkschrift entzogen. Die mit antisemitischen Parolen versehenen Wagen reihten sie allerdings widerspruchslos in ihre Umzüge ein.
Kommerzielle Überlegungen spielten in der modernen Fastnacht seit jeher eine zentrale Rolle. Ähnlich wie die Düsseldorfer am Beginn des neunzehnten Jahrhunderts neidisch auf Köln und seine Besuchermassen blickte, gierten die Kölner Karnevalisten nach den Fernsehmillionen, die die Mainzer mit ihrer Fernsehsendung "Mainz wie es singt und lacht" in ihre Karnevalskassen scheffelten. Heute ist Karneval im Rheinland ein blühender Wirtschaftszweig. Die Unternehmensberatung McKinsey berechnete allein für Köln den wirtschaftlichen Gesamtwert in der Karnevalssaison 1991/92 auf fünfhundert Millionen Mark.
Nur Kriege und Nachkriegszeiten konnten den "rheinischen Frohsinn" und den Geldsegen stoppen. Insofern ist der Titel von Hildegard Brogs Buch irreführend. Zwar hielten im 19. Jahrhundert weder Cholera noch Hochwasser den Kölner Rosenmontagszug auf. Der Golfkrieg 1991 ließ allerdings die Räder der Umzugswagen stillstehen. Hildegard Brog stellt diese letzte Zwangspause als Kristallisationspunkt für eine neue Karnevalsbewegung in Köln dar. Das Kölner Festkomitee rief vor zehn Jahren aus "Respekt vor der Reaktion der Bevölkerung auf den Krieg am Golf" zum Verzicht von Karnevalsveranstaltungen unter freiem Himmel auf. "Die Hüter des karnevalistischen Brauchtums verschanzten sich hinter ihrem rückwärtsgewandten Weltbild und drückten sich vor der Auseinandersetzung mit der ... politischen Wirklichkeit" (Brog). Die Kölner Alternativ-Karnevalsszene dagegen ergriff die Initiative und etablierte mit einem politisch inspirierten, karnevalesk umgesetzten Umzug am Karnevalssamstag eine neue Karnevalskultur. Der Karneval lebt. Alaaf und Helau!
JÜRGEN SCHMIDT
Hildegard Brog: "Was auch passiert: D'r Zoch kütt! Die Geschichte des rheinischen Karnevals". Campus Verlag, Frankfurt am Main, New York 2000. 310 S., 40 Abb., 16 Seiten Farbtafeln, geb., 58,- DM.
Christina Frohn: "Der organisierte Narr". Karneval in Aachen, Düsseldorf und Köln von 1823 bis 1914. Jonas Verlag, Marburg 2000. 374 S., 130 Abb., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
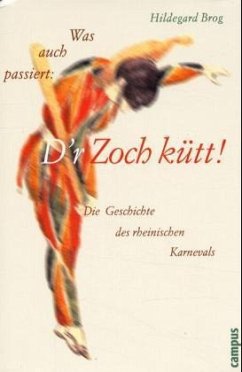



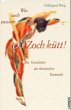

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2001