Vor-Michael-Moore-und-Harry-Potter-Ära, "Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken", erschienen bei Ullstein, ist von dieser Zeitung bei Erscheinen keiner Rezension gewürdigt und dennoch längst bei sechs-, wenn nicht siebenstelliger Auflagenhöhe angelangt. Dem amerikanischen Ehepaar Allen und Barbara Pease ist mit ihrer Studie, die für sich in Anspruch nimmt, "ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen" zu geben, das seltene Kunststück gelungen, sprichwörtlich zu werden. Sie stehen zumindest damit auf einer Stufe mit Autoren wie den Mitscherlichs und deren "Unfähigkeit zu trauern", Horkheimers und Adornos "Dialektik der Aufklärung" oder Oliver Sacks' "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte". Ihr Buch hat sich allerdings besser als jeder andere der genannten Titel verkauft.
Wer aber hat es wirklich durchgearbeitet? Zumindest siebzehn Leser kennen wir seit kurzem: Michelle Brehm, Michael Eid, Sylvia Fittig, Christian Geiser, Judith Glück, Markus Hausmann, Wolfgang Lehmann, Eileen Lüders, Eva Neidhardt, Katrin Nikoleyczik, Jana Rönicke, Jessica Sänger, Jeanette Schadow, Sigrid Schmitz, Torsten Wüstenberg, Claudia Quaiser-Pohl und Kirsten Jordan. Warum zählen wir sie auf? Weil diese siebzehn Autoren jeweils Teile des gerade erschienenen Buchs "Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken - und Männer ihnen Recht geben" geschrieben haben, der Umschlag aber nur die letztgenannten beiden Damen als Verfasserinnen ausweist. Ehre, wem Ehre gebührt.
Die Gruppe der siebzehn, die mit ihrem Werk etliche Halbwahrheiten im Erfolgsbuch der Peases richtigstellen wollen, besteht aus lauter Akademikern, sämtlich Psycho- und Biologen, die meisten mit enger Bindung an die Magdeburger Universität, wo auch die beiden Herausgeberinnen, die vom Verlag zu Verfasserinnen promoviert worden sind, forschen. Ihr Bildungsgang dürfte die kleine Schar also vom Gros der sonstigen Leser des Ehepaars Pease signifikant unterscheiden. In einer Hinsicht aber sind die siebzehn durchaus repräsentativ fürs Pease-Publikum: Frauen überwiegen deutlich. Das hat einen psychologischen Grund, den man dem neuen Buch entnehmen kann: Frauen neigen dazu, sich zu ihren Schwächen zu bekennen, Männer zu ihren Stärken. Woher weiß man das?
Das Schöne an wissenschaftlichen Studien ist ja, daß schon ihre Durchführung wieder zur Studie taugt. Als Eva Neidhardt eine Anzeige in die Zeitung setzte, mittels derer sie Probanden für einen Orientierungstest suchte, meldeten sich rund fünfzig Interessenten, jeweils zur Hälfte Männer und Frauen. "Die Motive für die Teilnahme an der Studie jedoch", schreibt sie, "die die Frauen und die Männer am Telefon nannten, unterschieden sich drastisch: Die Frauen folgten dem Aufruf überwiegend deshalb, weil sie Probleme sahen, sich zurechtzufinden, weil sie mit Orientierungsängsten kämpften und weil sie hofften, ihre Orientierungsfähigkeiten im Alltag durch die Teilnahme an der Studie zu verbessern. Die Männer hingegen nannten als wesentlichen Grund für ihre Teilnahme, daß sie ihre hervorragenden Fähigkeiten auf diesem Gebiet gern demonstrieren und der Wissenschaft zur Verfügung stellen wollten."
Nun könnte man aus dieser Beschreibung folgern, Männer seien selbstlos und Frauen egoistisch. Oder aber auch, Männer seien Angeber und Frauen bescheiden. Statistische Auswertungen haben bei aller scheinbaren Objektivität immer den Charme des Höchstpersönlichen. Es ist bekannt, daß Gutachten oder Erhebungen im Regelfall ergeben, was der Auftraggeber wünscht. Aber losgelöst von welcher Deutung auch immer, liefert die Beschreibung des Phänomens eine nunmehr empirisch abgesicherte Erklärung für den Erfolg des Pease-Buches bei Leserinnen: Sie wollen etwas lernen. Männer dagegen, die sich gern selbst darstellen wollen, dürften nur wenig Reiz darin erkennen, ein Buch zu lesen, daß ihnen schon im Titel bescheinigt, nicht zuhören zu können.
Die eine der beiden Titelbehauptungen der Peases sei allerdings so falsch wie die andere, behaupten nun Claudia Quaiser-Pohl, Kirsten Jordan und ihre fünfzehn Zuarbeiter. Denn die Studien, auf die die beiden Amerikaner sich gestützt haben, seien entweder veraltet, nicht repräsentativ oder falsch ausgewertet. Etwa die berühmten Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen Gehirngröße: Zwar stimme es, daß Männer bei gleicher Körpergröße gegenüber Frauen über etwas mehr an Gehirnmasse verfügen, aber die wiederum teilt sich in "graue" und "weiße Substanz", und über deren relative Verteilung und genaue Funktion streiten die Gelehrten noch. Auch ist unklar, was Volumen über Denkfähigkeit aussagt. Die in der Folge des Buchs der Peases in Männerzirkeln öfters gehörte herablassende Bemerkung: "Na ja, Frauen, zu kleines Gehirn" wäre also um ein Wort zu kürzen, um zumindest eine empirisch zutreffende Beschreibung zu erhalten.
Wogegen Claudia Quaiser-Pohl und Kirsten Jordan ankämpfen, ist aber vor allem die Verallgemeinerung wissenschaftlicher Befunde, die ja meist nur auf der Basis einer winzigen Stichprobe erfolgen können und als Ergebnis wiederum nur einen Durchschnittswert erbringen. Selbstverständlich gibt es Frauen, die einparken, und vielleicht sogar Männer, die zuhören können. Es spricht nur einiges dafür, daß es mehr Frauen als Männer gibt, die nicht einparken, und mehr Männer als Frauen, die nicht zuhören können. Und diese Schwächen sind Resultat anderer Stärken. Allerdings beschränkt sich das Buch von Claudia Quaiser-Pohl und Kirsten Jordan - und das ist nun eine echte Schwäche - fast ausschließlich auf die Betrachtung der Frauen. Die wurden im durchaus misogyn angehauchten Buch der Peases auch härter angegangen als die Männer, aber die monothematische Ausrichtung der Richtigstellung geht in dieser Konzentration noch weitaus weiter, bis hin zu Formulierungen, die eindeutig erkennen lassen, daß deren Verfasser ausschließlich mit Leserinnen rechnen: "Wenn Sie mal wieder mit einer Parklücke ringen, machen Sie's wie ein Mann und verweisen auf die fehlende Servolenkung."
Das ist leider auch schon der praktischste Hinweis des Buches, das sich ansonsten auf die Zusammenstellung zahlloser eigener und fremder Untersuchungen zur Gehirnaktivität erschöpft. Da die einzelnen Kapitel jeweils andere Autoren haben, wird etliches auch wiederholt, so etwa die Ausführungen zur "mentalen Rotation" ein halbes dutzendmal. So gut hören selbst wir Männer zu, daß es mit zwei oder drei Erwähnungen auch sein Bewenden hätte haben können.
ANDREAS PLATTHAUS
Claudia Quaiser-Pohl, Kirsten Jordan: "Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken - und Männer ihnen Recht geben". Über Schwächen, die gar keine sind. Eine Antwort auf A. & B. Pease. Verlag C. H. Beck, München 2004. 192 S., 70 Abb., br., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
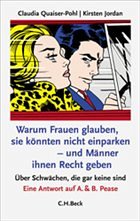




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.02.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.02.2004