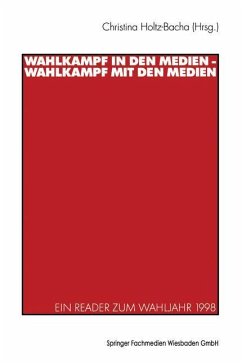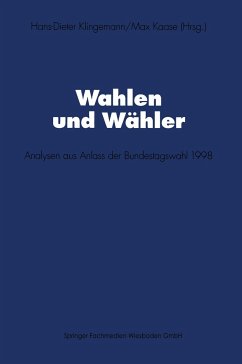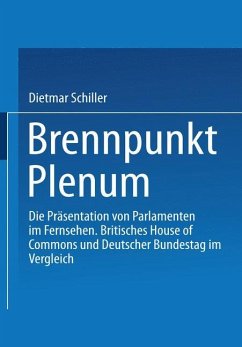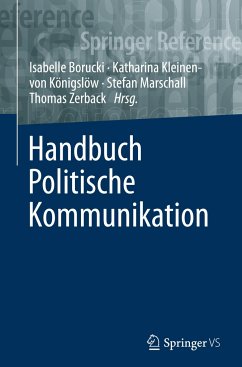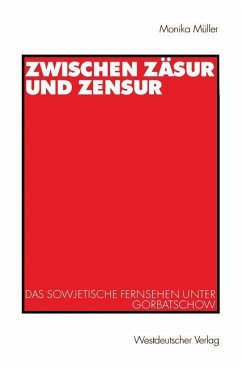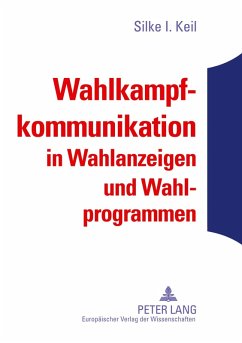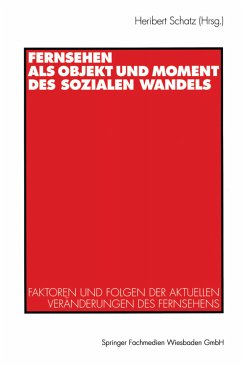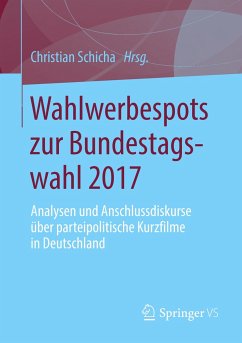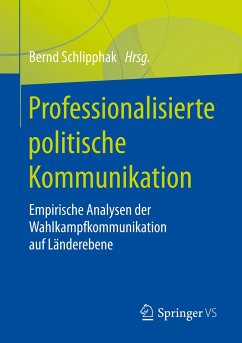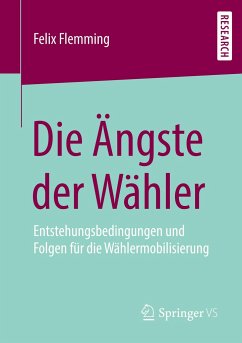Bildungsreisen in Sachen Wahlkampf aufmachen, scheint diese Einschätzung zu bestätigen. Christina Holtz-Bacha untersucht Wahlspots aus den Bundestagswahlkämpfen zwischen 1957 und 1998 und zeigt auf, wie sehr sich das Vorbild der Vereinigten Staaten tatsächlich bemerkbar macht. Die Autorin hat 417 Kurzfilme analysiert. Allerdings fallen die meisten Ergebnisse wenig überraschend aus. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Regierungsparteien das Erreichte loben, die Opposition Versäumtes anprangert. Aufgrund der Kürze der Spots lassen sich die Parteien auf komplexe Argumentationen nicht ein, Wirtschafts- und Sozialpolitik beherrschen die Themenauswahl.
Interessanter ist schon, daß Staatssymbole, beispielsweise Flagge und Bundesadler, von den Bundestagsparteien in ihren Spots nur selten gezeigt werden, sieht man einmal von der Kampagne der CDU im Vereinigungsjahr 1990 ab. Die Nationalhymne ist sogar so gut wie nie zu hören. Selbst 1990 erklang sie nur in zwei Prozent der Werbefilme. Wenn die Parteien Emotionen wecken wollen, zeigen sie blühende Landschaften oder lassen Kinder auftreten.
Kleine Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, haben es besonders schwer, eine aussichtsreiche Kampagne zu inszenieren. Weil sie sich teure Aufnahmen mit hohem technischen Aufwand nicht leisten können, lassen sie ihre Kandidaten direkt in die Kamera sprechen. Solche "talking heads" sind aber nur bei hohem Bekanntheitsgrad der Sprecher ein probates Werbemittel. Das wissen auch die großen Parteien, die deshalb insbesondere die Kanzlerkandidaten über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg häufig auftreten lassen. Doch schwankt ihr Anteil je nach Kampagne. Die SPD setzte beispielsweise 1961 und 1972 stark auf Willy Brandt, 1965 und 1969 - als seine Popularität zwischenzeitlich gesunken war - dagegen weniger. Helmut Kohl wurde 1990 und 1994 in den Mittelpunkt der CDU-Kampagne gerückt, 1998 wiederum zeigte sich das geschwundene Vertrauen der Union in Kohl auch daran, daß der Kanzler in den Werbesendungen zurücktrat. Zwar hat laut Holtz-Bacha mit Gerhard Schröder die Personalisierung einen neuen Höhepunkt erreicht, doch bleibe abzuwarten, ob sich darin ein Trend bemerkbar mache oder ob Schröder für eine personale Inszenierung besonders gut geeignet sei.
Sinnvoll ist die Unterscheidung Holtz-Bachas zwischen Personalisierung und Privatisierung. Die Spots beschränken sich zumeist darauf, die Kandidaten als kompetent zu zeigen. Auf weiter gehende Charakterisierungen wird verzichtet, das Privatleben ist tabu. Die wenigen Ausnahmen - Franz Josef Strauß beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel im Kreis seiner Familie - sind wohl genau deshalb in Erinnerung geblieben. Als Schröder 1998 sinnierend am Nordseestrand gezeigt wurde, war das gewissermaßen eine staatsmännisch grundierte Intimität.
Holtz-Bacha kommt zu dem Ergebnis, daß die Wahlspots nicht als Beleg für eine "Amerikanisierung" der deutschen Wahlkämpfe taugen. Vor allem aufgrund der strikten rechtlichen Regelungen - die Spots dürfen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen höchstens anderthalb Minuten lang sein und werden als Wahlsendung angekündigt, was ihnen viel von ihrer Wirkung raubt - nehmen sie in den Kampagnen hierzulande einen vergleichsweise bescheidenen Stellenwert ein. Es gibt in Deutschland zudem keinen eindeutigen Trend zu einer stärkeren Personalisierung, ebensowenig wie zu einer Emotionalisierung. Auch Angriffe auf den politischen Gegner - in den Vereinigten Staaten ein beliebtes Mittel - bleiben die Ausnahme.
Wenig anschaulich ist die im ganzen präzise gearbeitete Studie. Originalität und ästhetische Qualität der Spots sind keine Kriterien. Auch ohne repräsentative Untersuchung läßt sich wohl sagen, daß die Fernsehspots der Parteien in der großen Mehrzahl Beispiele unfreiwilliger Komik und hölzerner Politpädagogik bieten, die bei den Zielgruppen auf wenig Begeisterung stoßen. Die SPD-Kampagne zur Bundestagswahl 1998 hat hier neue Maßstäbe gesetzt. Sie war filmerisch anspruchsvoll, arbeitete mit Ironie und Überraschungseffekten. Zu diesem Grad von Professionalität werden sich im nächsten Wahlkampf auch die anderen Parteien aufschwingen müssen. Wenn das am Ende von der oft beklagten "Amerikanisierung" des deutschen Wahlkampfes übrigbleibt, dann kann es dem Fernsehzuschauer nur recht sein.
MATTHIAS ALEXANDER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
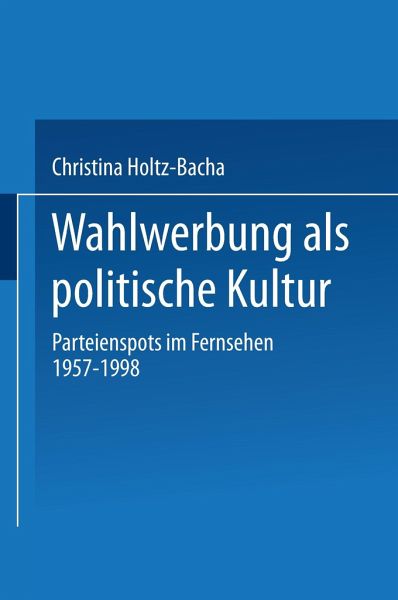






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.08.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.08.2001