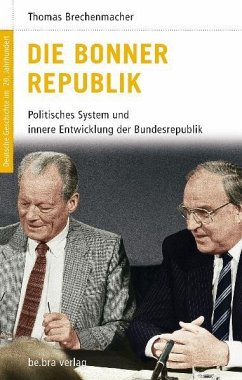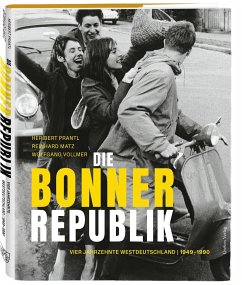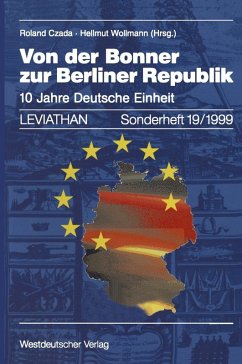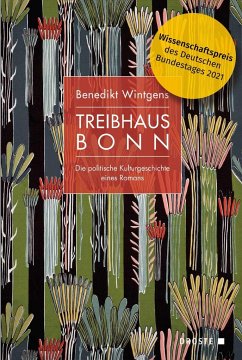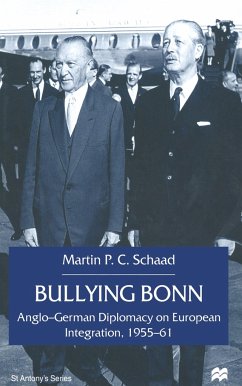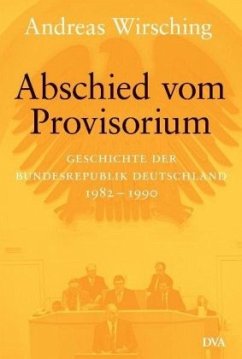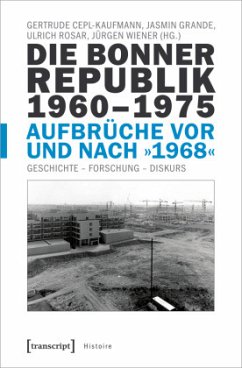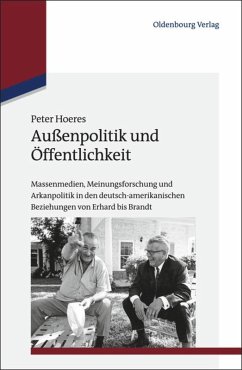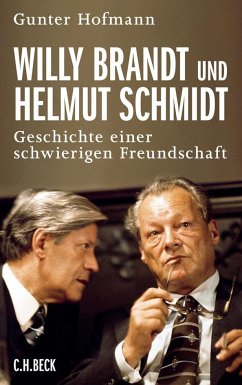ohne dabei die eigenen Interessen aus dem Auge zu verlieren. Ihr gegenseitiges Verhältnis wurde vor allem durch den Korea-Schock bestimmt. Denn die damit verbundene Aufwertung der Bundesrepublik zu einem, wenn auch zuerst noch "besetzten Verbündeten" begrenzte zunehmend den alliierten Durchsetzungsanspruch. Über das Verhältnis von Konrad Adenauer zu den Hohen Kommissaren sind wir durch Quelleneditionen gut informiert. Sie zeigen, mit welcher Härte mitunter die Auseinandersetzungen geführt wurden.
Zugleich bildete sich im Bonner Raum ein alliierter Mikrokosmos der verschiedenen Dienststellen mit einer Fülle von Mitarbeitern und Bediensteten aus, die von der jeweiligen Tradition und dem bürokratischen Stil der Herkunftsländer bestimmt waren. Über das Miteinander wie das Nebeneinander der Kommissare, ihres Personals und ihrer Gepflogenheiten bis hin zur Freizeitgestaltung werden wir gründlich informiert - etwa über die verschiedenen Dienstwagen, die Sonderzüge, aber auch über ihre Flugzeuge, die zugleich Statussymbole darstellten. Die Politik der Hohen Kommissare steht nicht im Vordergrund, sondern es geht um den Gesamteindruck, das tägliche Procedere auf verschiedenen Ebenen. Dazu gehörten die aufwendigen Neubauten ebenso wie die sportlichen Betätigungen, nicht zu vergessen das edle Waidwerk, das vornehmlich die Amerikaner - von jeder Art von Jagdschein unbeschwert - extensiv ausübten. Das Lokalkolorit ist daher von Wichtigkeit. Nicht umsonst weist Helmut Vogt darauf hin, daß im Stadtarchiv Bonn "noch mancher Schatz zur Frühgeschichte der Bundesrepublik schlummert".
Der Titel scheint nicht glücklich gewählt. Im Text ist häufig und richtiger von Tutoren die Rede, das soll heißen, die Hohen Kommissare hätten eine mehr assistierende Tätigkeit ausgeübt und mit den kooperationswilligen Deutschen zusammengearbeitet, ohne zu vergessen, wer letztlich das Sagen hatte. So ist die häufig verwandte Bezeichnung für McCloy als "US-Statthalter" ungenau. Er war zwar die beherrschende Figur in Bonn, nicht aber als Vertreter der stärksten Macht, sondern durch seinen persönlichen Einsatz, mit dem er schwierige Probleme wie den Schumanplan und den Vertrag mit Israel der Lösung entscheidend näher brachte. Bei seinem Nachfolger James B. Conant würde niemand auf die Idee kommen, in ihm einen Statthalter zu sehen, sondern eher einen Universitätspräsidenten, der sich in die Politik verirrt hatte.
Wir erleben also die Bonner Politik aus einem besonderen Blickwinkel. Da geht es nicht nur um die politischen Entscheidungen, sondern auch um die äußere Erscheinung, das Protokoll, die Autokolonnen und das militärische Begleitpersonal. Die unterschiedliche Perspektive zeigt sich besonders deutlich 1949 beim Besuch des gerade ernannten Bundeskanzlers bei den Hohen Kommissaren auf dem Petersberg. Da lernen wir, daß Adenauer durch ein Schreiben von Bundespräsident Theodor Heuss zu diesem Besuch "legitimiert" wurde. Nach dem Empfang habe es bei den Gesprächen auf der Terrasse "ein Glas Sekt - in alliierter Überlieferung Champagner" gegeben. Solche Details verfolgen den Leser gnadenlos.
Auf dieser Ebene kommt es sogar zu dem Versuch, das überlieferte Bild zu revidieren. So bei der berühmten Protokollwidrigkeit, die Adenauer sich auf dem Petersberg leistete, als er den Teppich betrat, auf dem die Kommissare standen. Das Foto, wie er auf der einen Ecke des Teppichs stand, ist eindeutig. Wer sich mit Adenauer beschäftigt hat, weiß, wie sehr ihn zeitlebens Diskriminierungen reizten. Hier ist Vogt aber ganz entschieden: "Nichts von der berühmten Teppich-Szene." Aber sogleich erfolgt die teilweise Rücknahme: "Wenn sie wirklich in der Form stattgefunden hat, hat die alliierte Seite die kleine Eigenmächtigkeit des deutschen Regierungschefs wohl nicht so ernst genommen." Denn die offizielle Geschichte der Hohen Kommission habe sie nicht erwähnt! Kleinkarierter geht es nicht. Auf die bemerkenswerte Ansprache Adenauers bei diesem Anlaß geht er kaum ein. Der Kanzler hatte auf das nun in Kraft tretende Besatzungsstatut Bezug genommen und bereits zum Zeitpunkt der Übergabe dessen Revision angemahnt und seiner Forderung dadurch Nachdruck verliehen, daß er auf den "Triebsand der Millionen Flüchtlinge" hinwies, die ohne rasche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage eine Gefahr für ganz Westeuropa darstellten. Gut wird jedoch bei der Darstellung der ersten Arbeitssitzungen auf dem Petersberg das Durchsetzungsvermögen Adenauers herausgearbeitet, wie dieser sich bei den Hohen Kommissaren Respekt verschaffte.
Bei dem ersten, gründlich mißlungenen Besuch des französischen Außenministers Robert Schuman geht Vogt der rheinische Patriotismus durch, als er dessen Fahrt aus dem besatzungsfreien Bonn in die selbstverständlich in der französischen Zone gelegene Residenz von François-Poncet schildert. Denn die deutsche Polizeiformation, die den Minister in Bonn eskortiert hatte, "behielt auch in der französischen Zone den Begleitschutz in der Hand, eine Geste des Souveränitätsanspruchs, der die altgedienten Besatzungsoffiziere in Schumans Delegation nicht wenig irritierte". Das ist Revisionspolitik aus der Polizistenperspektive. Sie wird der tatsächlichen Leistung dieser Politik kaum gerecht.
HENNING KÖHLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.04.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.04.2005