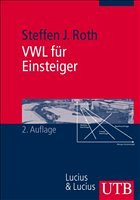
VWL für Einsteiger
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Der Was ist der Markt? Was regelt der Markt? Wie würde es der Weihnachtsmann machen? Was bleibt, wenn der Markt versagt? Und wie steht es mit der Gerechtigkeit und dem Primat der Politik? Eine fundierte Einführung in das theoretische Instrumentarium ist zum Verständnis des ökonomischen Gedankengerüsts unumgänglich. In diesem Buch wird allerdings die Modelltheorie soweit wie möglich einfach und beispielreich gestaltet. Die verwendete Mathematik bleibt auf die Grundrechenarten beschränkt. Die Volkswirtschaftslehre kann Wesentliches und Wertvolles zur Analyse, Erklärung und Lösung der P...
Der Was ist der Markt? Was regelt der Markt? Wie würde es der Weihnachtsmann machen? Was bleibt, wenn der Markt versagt? Und wie steht es mit der Gerechtigkeit und dem Primat der Politik? Eine fundierte Einführung in das theoretische Instrumentarium ist zum Verständnis des ökonomischen Gedankengerüsts unumgänglich. In diesem Buch wird allerdings die Modelltheorie soweit wie möglich einfach und beispielreich gestaltet. Die verwendete Mathematik bleibt auf die Grundrechenarten beschränkt. Die Volkswirtschaftslehre kann Wesentliches und Wertvolles zur Analyse, Erklärung und Lösung der Probleme unserer Gesellschaft beitragen. Mit den hier vermittelten Methoden und Denkanstößen werden die Leser in die Lage versetzt, wirtschaftliche Zusammenhänge leichter zu erkennen und eigene Positionen vor diesem Hintergrund zu überprüfen.
Die FAZ urteilte über die 1. Auflage:
"Die große Herausforderung für einen Einführungstext in die Volkswirtschaftslehre besteht als- darin, die Grundlagen des Faches einerseits verständlich darzustellen, aber andererseits auch immer noch ein gewisses wissenschaftliches Niveau zu wahren. Steffen Roth meistert diese Herausforderung auf gelungene Art und Weise, ...dazu tragen entscheidend die vielen anschaulichen Beispiele und die klaren Formulierungen bei."
Inhaltsverzeichnis:
I. Volkswirtschaftliche Grundgedanken
1. Methodologischer Individualismus
2. Konsumentensouveränität
3. Nutzenmaximierung und rationales Verhalten
4. Knappheit und Opportunitätskosten
5. Marginalbetrachtung
6. Tausch und Handel, Spezialisierung und Arbeitsteilung
7. Komparative Vorteile
8. Pareto-Kriterium, allokative Effizienz und Prozessbetrachtung
II. Die Theorie der Haushalte
1. Vorbemerkung: Wozu diese Modell-Technik?
2. Haushalte suchen nach dem Besten, was sie sich leisten können
3. Die Budgetbeschränkung und die Budgetgerade
3.1. Zusammengesetztes Gut
3.2. Veränderungen der Parameter Einkommen und Preise
3.3. Zur Interpretation der Steigung von Budgetgeraden
4. Die Präferenzen
5. Die Indifferenzkurven
5.1. Verschiedene Formen von Indifferenzkurven
5.2. Zur Interpretation der Steigung von Indifferenzkurven
6. Die optimale Nachfrageentscheidung
7. Veränderungen der Parameter der individuellen Nachfrage
7.1. Änderung der Nachfrage bei Einkommensänderung
7.1.1. Normale Güter
7.1.2. Superiore Güter
7.1.3. Inferiore Güter
7.2. Änderung der Nachfrage bei Preisänderung
7.3. Substitutions- und Einkommenseffekt
7.3.1. Der Substitutionseffekt
7.3.2. Der Einkommenseffekt
7.3.3. Der Gesamteffekt
7.3.4. Ein Zahlenbeispiel
8. Von der individuellen Nachfrage zur Marktnachfrage
9. Das individuelle Arbeitsangebot der Haushalte
9.1. Die individuelle Arbeitsangebotskurve
9.1.1. Ein zusätzlicher Einkommenseffekt
9.1.2. Die inverse Arbeitsangebotskurve
10. Das aggregierte Gesamtangebot auf dem Arbeitsmarkt
III. Die Theorie der Unternehmen
1. Die Produktionstechnik
1.1. Das Durchschnittsprodukt
1.2. Das Grenzprodukt
1.3. Die Produktionsfunktion
2. Die Kosten
2.1. Die Fixkosten, die variablen Kosten und die totalen Kosten
2.2. Die Durchschnittskosten
2.3. Die Grenzkosten
2.4. Das Verhältnis der Grenzkosten- und der Durchschnittskostenkurve
3. Das Angebot einer Firma im Polypol
3.1. Gewinnmaximierung des Konkurrenzunternehmers
3.1.1. Wahl der optimalen Produktionstechnologie
3.1.2. Die Wahl der optimalen Produktionsmenge
4. Die langfristige Angebotskurve eines polypolistischen Unternehmens
5. Vom individuellen Angebot polypolistischer Unternehmer zum Marktangebot
IV. Das Marktgleichgewicht
1. Das Angebot im langfristigen Marktgleichgewicht
1.1. Die Gleichgewichtsmenge
1.2. Der Gleichgewichtspreis
1.3. Machen Unternehmen nicht doch Gewinne?
2. Der schmerzhafte Weg zum markträumenden Gleichgewicht
2.1. Beispiel zum Ausschluss einzelner Nachfrager vom Konsum
2.2. Beispiel zum Ausschluss einzelner Anbieter vom Markt
2.3. Freie Preise dienen als volkswirtschaftlich wünschenswertes Steuerungssystem
3. Die Wohlfahrtswirkung von Märkten I: Edgeworthbox
3.1. Die pareto-effiziente Güterallokation in der Edgeworthbox
3.2. Pareto-effiziente Allokation und markträumendes Gleichgewicht
4. Die Wohlfahrtswirkung von Märkten II: Rentenbetrachtung
4.1. Konsumenten- und Produzentenrente
4.2. Der Soziale Überschuss
5. Hauptsätze der Wohlfahrtsökonomik
V. Der Weihnachtsmann und die Idee der Planwirtschaft
1. Der wohlmeinende Diktator
2. Vorteile und Schwächen des Marktsystems
3. Planwirtschaft als überlegene Alternative zum freien Markt?
VI. Der Markt regelt doch nicht alles: Die Marktversagenstheorie
1. Marktversagen begründet nicht zwangsläufig Staatseingriffe
2. Das Gefangenendilemma
3. Öffentliche Güter
3.1. Theoretisch effiziente Bereitstellung öffentlicher Güter
3.2. Das Freerider-Problem
3.3. Staatlicher Eingriff zur Bereitstellung öffentlicher Güter?
4. Externe Effekte (Externalitäten)
4.1. Positive und negative externe Effekte
4.1.1. Ein Beispiel zu Konsumexternalitäten
4.1.2. Ein Beispiel zu Produktionsexternalitäten
4.2. Theoretisch effiziente Bereitstellung bei Vorliegen externer Effekte
4.2.1. Die Verhandlungslösung
4.2.2. Die Pigou-Steuer
4.3. Annäherungen an effiziente Lösungen in der Praxis
4.3.1. Die Ökosteuer nach dem Standard-Preis-Ansatz
4.3.2. Die Lösung durch Zertifikate
4.4. Staatlicher Eingriff zur Internalisierung externer Effekte?
5. Natürliches Monopol
5.1. Ineffizienz bei Vorliegen einer Monopolstellung
5.1.1. Dynamische Ineffizienz: Wohlfahrtsverluste auf Grund mangelnder Innovationen
5.1.2. Statische Ineffizienz: Wohlfahrtsverluste auf Grund von Mengeneinschränkungen
5.2. Vorübergehende oder staatlich geschützte Monopole sind kein Marktversagen
5.3. Das Marktversagen beim natürlichen Monopol
5.3.1. Die Eigenschaften natürlicher Monopole
5.3.2. Die Stabilität des natürlichen Monopols
5.4. Staatlicher Eingriff zur Regulierung natürlicher Monopole?
6. Asymmetrische Information
6.1. Adverse Selektion
6.1.1. Das Beispiel des Gebrauchtwagen-Marktes
6.1.2. Das Beispiel der Versicherung
6.2. Moral hazard
6.2.1. Das Beispiel der Versicherung
6.3. Der Zusammenhang asymmetrischer Information und externer Effekte
6.4. Staatlicher Eingriff bei Vorliegen asymmetrischer Information?
6.5. Private Möglichkeiten, das Marktversagen bei asymmetrischer Information teilweise
zu heilen
6.5.1. Signaling
6.5.2. Screening
VII. Verteilungspolitik und Meritorik
1. Verteilungspolitische Eingriffe
1.1. Gerechtigkeitsvorstellungen
1.2. Umverteilung kann effizient sein: Soziale Mindestsicherung
1.2.1. Das Versicherungsmotiv
1.2.2. Die Internalisierung von Armutsexternalitäten
1.3. Anforderungen an eine effiziente Umverteilung
1.4. Umverteilung durch Markteingriffe ist ineffizient
1.4.1. Unwiederbringliche Wohlfahrtsverluste bei Abweichung vom Gleichgewicht
1.4.2. "Transfer in cash" versus "transfer in kind"
1.5. Obergrenze wünschenswerter Umverteilungspolitik
2. Meritorische Eingriffe
VIII. Politik als alternativer Allokationsmechanismus
1. Einstimmigkeit in Abstimmungsprozessen
2. Delegation von politischen Entscheidungen
2.1. Doppeltes Prinzipal-Agent-Problem
2.2. Das Prinzipal-Agent-Problem zwischen Wählern und Politikern
2.2.1. Die Orientierung am Median-Wähler
2.2.2. Das Wahlparadoxon und die rationale Ignoranz der Wähler
2.3. Bürokraten als Agenten der Politiker
3. Die Rolle plakativer Vereinfachungen
4. Medien und Interessengruppen
5. Das Primat der Politik?
IX. Epilog: Ökonomische Politikberatung
1. Zum Frustrationspotenzial wirtschaftspolitischer Beratung
2. Politischer Diskurs als Dialog
3. Empfiehlt sich eine größere Konzentration auf die Durchsetzbarkeit von Vorschlägen?
4. Wirtschaftswissenschaftliche Politikberatung ist nicht gleichzusetzen mit
Wirtschaftspolitik
Die FAZ urteilte über die 1. Auflage:
"Die große Herausforderung für einen Einführungstext in die Volkswirtschaftslehre besteht als- darin, die Grundlagen des Faches einerseits verständlich darzustellen, aber andererseits auch immer noch ein gewisses wissenschaftliches Niveau zu wahren. Steffen Roth meistert diese Herausforderung auf gelungene Art und Weise, ...dazu tragen entscheidend die vielen anschaulichen Beispiele und die klaren Formulierungen bei."
Inhaltsverzeichnis:
I. Volkswirtschaftliche Grundgedanken
1. Methodologischer Individualismus
2. Konsumentensouveränität
3. Nutzenmaximierung und rationales Verhalten
4. Knappheit und Opportunitätskosten
5. Marginalbetrachtung
6. Tausch und Handel, Spezialisierung und Arbeitsteilung
7. Komparative Vorteile
8. Pareto-Kriterium, allokative Effizienz und Prozessbetrachtung
II. Die Theorie der Haushalte
1. Vorbemerkung: Wozu diese Modell-Technik?
2. Haushalte suchen nach dem Besten, was sie sich leisten können
3. Die Budgetbeschränkung und die Budgetgerade
3.1. Zusammengesetztes Gut
3.2. Veränderungen der Parameter Einkommen und Preise
3.3. Zur Interpretation der Steigung von Budgetgeraden
4. Die Präferenzen
5. Die Indifferenzkurven
5.1. Verschiedene Formen von Indifferenzkurven
5.2. Zur Interpretation der Steigung von Indifferenzkurven
6. Die optimale Nachfrageentscheidung
7. Veränderungen der Parameter der individuellen Nachfrage
7.1. Änderung der Nachfrage bei Einkommensänderung
7.1.1. Normale Güter
7.1.2. Superiore Güter
7.1.3. Inferiore Güter
7.2. Änderung der Nachfrage bei Preisänderung
7.3. Substitutions- und Einkommenseffekt
7.3.1. Der Substitutionseffekt
7.3.2. Der Einkommenseffekt
7.3.3. Der Gesamteffekt
7.3.4. Ein Zahlenbeispiel
8. Von der individuellen Nachfrage zur Marktnachfrage
9. Das individuelle Arbeitsangebot der Haushalte
9.1. Die individuelle Arbeitsangebotskurve
9.1.1. Ein zusätzlicher Einkommenseffekt
9.1.2. Die inverse Arbeitsangebotskurve
10. Das aggregierte Gesamtangebot auf dem Arbeitsmarkt
III. Die Theorie der Unternehmen
1. Die Produktionstechnik
1.1. Das Durchschnittsprodukt
1.2. Das Grenzprodukt
1.3. Die Produktionsfunktion
2. Die Kosten
2.1. Die Fixkosten, die variablen Kosten und die totalen Kosten
2.2. Die Durchschnittskosten
2.3. Die Grenzkosten
2.4. Das Verhältnis der Grenzkosten- und der Durchschnittskostenkurve
3. Das Angebot einer Firma im Polypol
3.1. Gewinnmaximierung des Konkurrenzunternehmers
3.1.1. Wahl der optimalen Produktionstechnologie
3.1.2. Die Wahl der optimalen Produktionsmenge
4. Die langfristige Angebotskurve eines polypolistischen Unternehmens
5. Vom individuellen Angebot polypolistischer Unternehmer zum Marktangebot
IV. Das Marktgleichgewicht
1. Das Angebot im langfristigen Marktgleichgewicht
1.1. Die Gleichgewichtsmenge
1.2. Der Gleichgewichtspreis
1.3. Machen Unternehmen nicht doch Gewinne?
2. Der schmerzhafte Weg zum markträumenden Gleichgewicht
2.1. Beispiel zum Ausschluss einzelner Nachfrager vom Konsum
2.2. Beispiel zum Ausschluss einzelner Anbieter vom Markt
2.3. Freie Preise dienen als volkswirtschaftlich wünschenswertes Steuerungssystem
3. Die Wohlfahrtswirkung von Märkten I: Edgeworthbox
3.1. Die pareto-effiziente Güterallokation in der Edgeworthbox
3.2. Pareto-effiziente Allokation und markträumendes Gleichgewicht
4. Die Wohlfahrtswirkung von Märkten II: Rentenbetrachtung
4.1. Konsumenten- und Produzentenrente
4.2. Der Soziale Überschuss
5. Hauptsätze der Wohlfahrtsökonomik
V. Der Weihnachtsmann und die Idee der Planwirtschaft
1. Der wohlmeinende Diktator
2. Vorteile und Schwächen des Marktsystems
3. Planwirtschaft als überlegene Alternative zum freien Markt?
VI. Der Markt regelt doch nicht alles: Die Marktversagenstheorie
1. Marktversagen begründet nicht zwangsläufig Staatseingriffe
2. Das Gefangenendilemma
3. Öffentliche Güter
3.1. Theoretisch effiziente Bereitstellung öffentlicher Güter
3.2. Das Freerider-Problem
3.3. Staatlicher Eingriff zur Bereitstellung öffentlicher Güter?
4. Externe Effekte (Externalitäten)
4.1. Positive und negative externe Effekte
4.1.1. Ein Beispiel zu Konsumexternalitäten
4.1.2. Ein Beispiel zu Produktionsexternalitäten
4.2. Theoretisch effiziente Bereitstellung bei Vorliegen externer Effekte
4.2.1. Die Verhandlungslösung
4.2.2. Die Pigou-Steuer
4.3. Annäherungen an effiziente Lösungen in der Praxis
4.3.1. Die Ökosteuer nach dem Standard-Preis-Ansatz
4.3.2. Die Lösung durch Zertifikate
4.4. Staatlicher Eingriff zur Internalisierung externer Effekte?
5. Natürliches Monopol
5.1. Ineffizienz bei Vorliegen einer Monopolstellung
5.1.1. Dynamische Ineffizienz: Wohlfahrtsverluste auf Grund mangelnder Innovationen
5.1.2. Statische Ineffizienz: Wohlfahrtsverluste auf Grund von Mengeneinschränkungen
5.2. Vorübergehende oder staatlich geschützte Monopole sind kein Marktversagen
5.3. Das Marktversagen beim natürlichen Monopol
5.3.1. Die Eigenschaften natürlicher Monopole
5.3.2. Die Stabilität des natürlichen Monopols
5.4. Staatlicher Eingriff zur Regulierung natürlicher Monopole?
6. Asymmetrische Information
6.1. Adverse Selektion
6.1.1. Das Beispiel des Gebrauchtwagen-Marktes
6.1.2. Das Beispiel der Versicherung
6.2. Moral hazard
6.2.1. Das Beispiel der Versicherung
6.3. Der Zusammenhang asymmetrischer Information und externer Effekte
6.4. Staatlicher Eingriff bei Vorliegen asymmetrischer Information?
6.5. Private Möglichkeiten, das Marktversagen bei asymmetrischer Information teilweise
zu heilen
6.5.1. Signaling
6.5.2. Screening
VII. Verteilungspolitik und Meritorik
1. Verteilungspolitische Eingriffe
1.1. Gerechtigkeitsvorstellungen
1.2. Umverteilung kann effizient sein: Soziale Mindestsicherung
1.2.1. Das Versicherungsmotiv
1.2.2. Die Internalisierung von Armutsexternalitäten
1.3. Anforderungen an eine effiziente Umverteilung
1.4. Umverteilung durch Markteingriffe ist ineffizient
1.4.1. Unwiederbringliche Wohlfahrtsverluste bei Abweichung vom Gleichgewicht
1.4.2. "Transfer in cash" versus "transfer in kind"
1.5. Obergrenze wünschenswerter Umverteilungspolitik
2. Meritorische Eingriffe
VIII. Politik als alternativer Allokationsmechanismus
1. Einstimmigkeit in Abstimmungsprozessen
2. Delegation von politischen Entscheidungen
2.1. Doppeltes Prinzipal-Agent-Problem
2.2. Das Prinzipal-Agent-Problem zwischen Wählern und Politikern
2.2.1. Die Orientierung am Median-Wähler
2.2.2. Das Wahlparadoxon und die rationale Ignoranz der Wähler
2.3. Bürokraten als Agenten der Politiker
3. Die Rolle plakativer Vereinfachungen
4. Medien und Interessengruppen
5. Das Primat der Politik?
IX. Epilog: Ökonomische Politikberatung
1. Zum Frustrationspotenzial wirtschaftspolitischer Beratung
2. Politischer Diskurs als Dialog
3. Empfiehlt sich eine größere Konzentration auf die Durchsetzbarkeit von Vorschlägen?
4. Wirtschaftswissenschaftliche Politikberatung ist nicht gleichzusetzen mit
Wirtschaftspolitik





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.01.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.01.2007