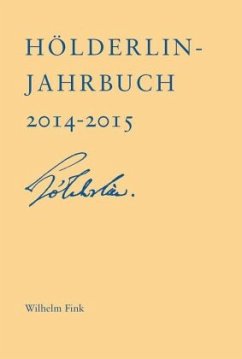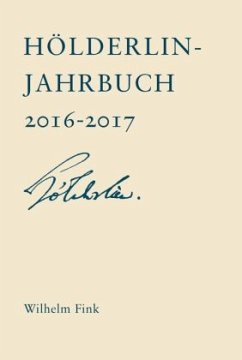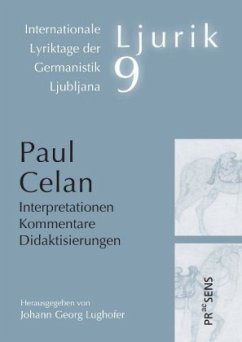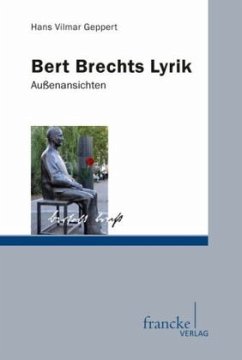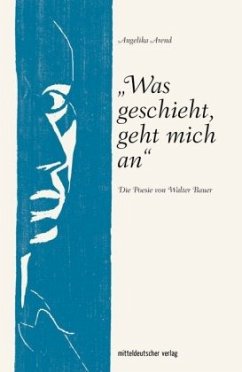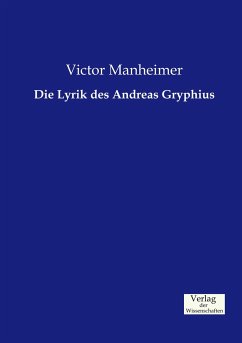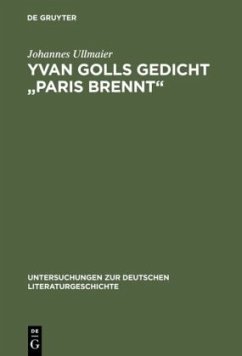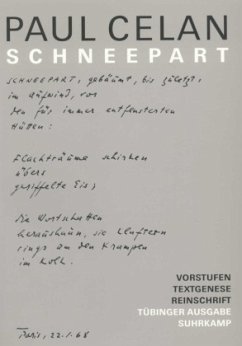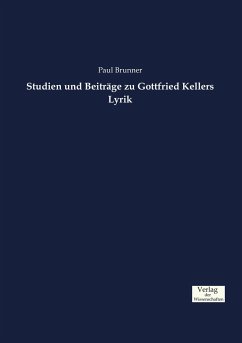Zeugnissen zu belegen. Zu den großen Figuren, die sich dieser Aufgabe angenommen haben, gehört Bernhard Böschenstein. Nun ist, passend zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag vor acht Wochen, ein Sammelband von Vorträgen und Aufsätzen erschienen, die der Genfer Emeritus in den vergangenen drei Jahrzehnten gehalten und die er bezeichnenderweise unter das Thema "Filiationen der Dichtung von Hölderlin bis Celan" gestellt hat. Denn er versteht seine Arbeit als Ahnenforschung.
Ein gutes Beispiel dafür ist Hofmannsthal selbst: An ihm führt Böschenstein vor, inwiefern jenes Goethe-Zitat nur das Signal eines implizit mittransportierten Menschenbildes sei. Bei Goethe lautet die Fortsetzung nämlich: "Hieraus ersehen wir, daß des Menschen Leben nur insofern etwas wert ist, als es eine Folge hat." Überträgt man den Spruch auf den Dichter, erhält man Hofmannsthals Selbstverständnis - und Böschensteins Perspektive auf die Literaturgeschichte. Die gewichtigen Stimmen der Literatur, so zeigt er in filigranen Studien, haben durch ihr Werk für Nachkommenschaft gesorgt und sind ihrerseits ohne Vorgänger und Vorbilder nicht zu denken, ja, sie bezogen gerade erst durch ihre Arbeit am Kollegen Impulse für das eigene Schaffen.
Bei Hölderlin laufen die meisten Fäden zusammen, die Böschenstein durch die deutsche Lyrik zieht. Er scheint dabei einem Diktum Stefan Georges zu folgen, der Hölderlin aufgrund von dessen visionären Qualitäten zum deutschen "Urdichter" erklärt und verklärt hatte. Nichts verabscheut Böschenstein dabei mehr als die Unterstellung, ein Dichter habe das Werk eines Klassikers "bedenkenlos als Steinbruch benutzt", wie Reinhold Grimm es einmal über den Umgang Georg Trakls mit Hölderlin behauptet hat.
Böschensteins Verständnis von produktiver Rezeption hat nichts mit Tagebau und Anspielung zu tun, sondern fühlt sich der Idee des Erbes verpflichtet. Wenn es darum geht, wie Trakl sich einzelne Passagen aus Hölderlins Gedichten aneignet, dann spricht der Interpret in beinahe religiösem Duktus von Trakls "Sohnschaft", die nicht nur als Herausforderung, sondern bisweilen auch als Last erscheint, wenn dabei schwermütige "Tönungen" festzustellen sind und sich der Autor selbst als der "schwächere Nachklang" inszeniert. Damit soll durchaus nicht der Eindruck entstehen, Literaturhistorie sei Verfallsgeschichte. Gerade in der Art und Weise der dichterischen Rezeption liegen für Böschenstein epochale Innovationen. Die Enkel, die ihn interessieren, sind keine Epigonen, sondern oft renitente Gegenspieler.
Das führt er am Beispiel jener Übersetzungen vor, die Paul Celan von Gedichten Paul Valérys anfertigte. Dort nämlich, wo Valéry feierlich und metaphysisch wird, reagiert Celans deutsche Fassung um so nüchterner, ja "abschätziger". Gerade diese "sträubige Wider-Sprache" betrachtet Böschenstein als besonders ernsthafte Antwort. Bei Celans Lektüre der Romane Jean Pauls dagegen erweist sich der virtuelle Dialog, den der Philologe nach Durchsicht der Anstreichungen in Celans sechzigbändiger Jean-Paul-Ausgabe rekonstruiert, als produktive Suche nach Schützenhilfe für die Abwehr "klassizistischer Stofflosigkeit".
Böschenstein vernetzt die Literatur auf diese Weise zu einem eigenen "Buch der Freunde", die sich als einsame Wölfe auf dem Höhenkamm der Sprachkunst begegnen. Hier bleiben sie unter sich und spüren kaum einen Hauch von den Stürmen der Historie oder der Geistesgeschichte; allenfalls die Französische Revolution, der Erste Weltkrieg oder der Holocaust werden als dichtungsrelevante historische Erschütterungen zugelassen. Es zählt zu Böschensteins Eigenarten, daß er sich dabei sympathetisch in die Poetik der Dichter hineindenkt, deren Texte er seziert. Das gilt nicht nur für Paul Celan, den er noch persönlich kannte. Bei Stefan George, der nach seiner Bekanntschaft mit Mallarmé nur noch die "dem Gedicht zugehörige Realität" ungestört von Raum und Zeit gelten lassen wollte, läßt er sich auf dessen Idee der "geistigen Landschaft" ein, um in ihr der "selbstgesteuerten Magie" des Dichters nachzuwandern.
Dieses puristische Dichtungs- und Deutungsverständnis hat sich über die Jahrzehnte hinweg eine erstaunlich konstante Diktion fernab jeglichen Jargons bewahren können. Schon 1977 erschien von Böschenstein ein Sammelband zur Lyrik von Hölderlin bis Celan, damals unter dem Titel "Leuchttürme", was einem Gedicht Charles Baudelaires nachempfunden war, in dem dieser eine Genealogie bedeutender Maler besingt. Damals schrieb Böschenstein, Baudelaire habe sich in den poetischen Künstlerbildern seine eigene "denkende Einsamkeit" gespiegelt. Wenn er die Aristokratie der Schöpfer über die Metaphern des Erbes, des Dialogs oder der Spiegelung zusammenhalten will, muß er freilich eingestehen, daß seine Darstellung der Einflüsse und Bezüge auf Vermutungen angewiesen ist und nicht ohne eine gewisse Portion Vertrauen in die eigene Intuition und Belesenheit auszukommen vermag.
Den Begriff der "Intertextualität", der vor einiger Zeit just aus ebendieser epistemologischen Not heraus geboren wurde, ignoriert Böschenstein. Mit einer Forschung, vor der alle Texte gleich und nahezu unabhängig von den sie erzeugenden Individuen sind, will er nichts zu tun haben. Als einer der letzten Idealisten seines Faches plädiert er mit seinem Werk statt dessen unbeirrt und nicht ohne Charme für eine Theorie der Intergenialität.
ROMAN LUCKSCHEITER
Bernhard Böschenstein: "Von Morgen nach Abend". Filiationen der Dichtung von Hölderlin zu Celan. Wilhelm Fink Verlag, München 2006. 377 S., geb., 49,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
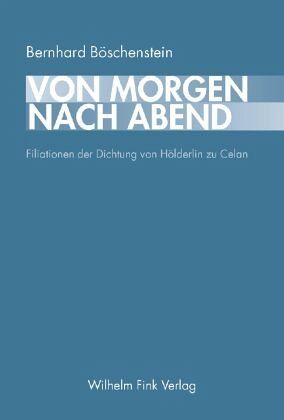




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2006