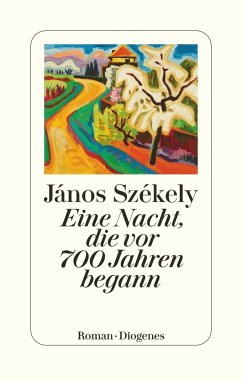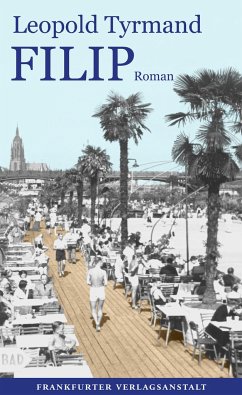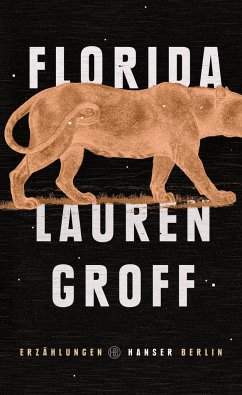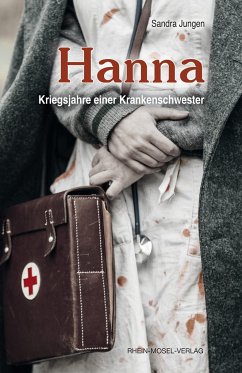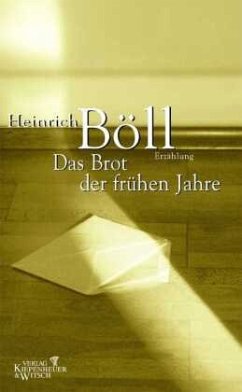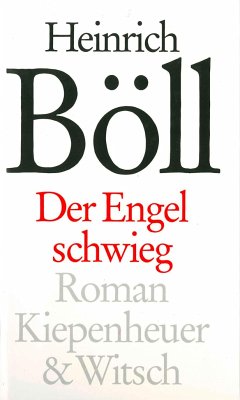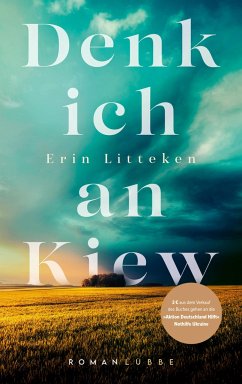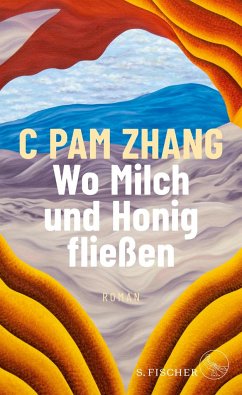Alltags widmet, die sie bald nur noch ersehnt.
Das ist die Versuchsanordnung des einzigen Romans von Julian Maclaren-Ross, ein herrlich sardonisches Zeitporträt aus der südenglischen Provinz, 1947 im Original erschienen und jetzt erstmals überhaupt auf Deutsch erhältlich. Es zeigt die Alltagssorgen eines umtriebigen jungen Mannes namens Fanshawe, der das Leben und die Frauen liebt, aber nie ausreichend Geld hat, um sich Frauen zu leisten und das Leben zu gestalten, wie er gerne will - mit starken Drinks und scharfen Partys. Die Geschäfte laufen schlecht: Als Staubsaugervertreter geht er von Tür zu Tür, um den lokalen Hausfrauen die Vorzüge der neuen Blas- und Saugtechnik zu vermitteln, scheitert aber beim Verkaufen regelmäßig an den Sparzwängen, denen auch die aufstrebende suburbane Mittelklasse unterliegt. Diese tägliche Trübsal beginnt sich erst etwas zu bessern, als er einem befreundeten Kollegen, der zur See anheuert, verspricht, sich derweil um dessen Ehefrau zu kümmern. Daraus folgt bald ein heißer amour fou, der immerhin den halben Sommer währt.
All das ist, zugegeben, weder sonderlich aufregend noch spannend, aber es wird aus der Erlebnisperspektive Fanshawes mit so viel trockenem Witz und desillusionierter Lebensklugheit dargeboten, dass man seinen traurigen Bericht in einem Zug mit riesigem Vergnügen liest. Bei allen Alltagsplagen, die er schildert, wirkt er niemals larmoyant, heischt er nie um Anteilnahme, sondern kultiviert den Gestus schnodderiger Selbstbehauptung, die dem fortdauernden Leidensdruck ein gezieltes "Jetzt erst recht" abtrotzt. Den lakonischen Erzählstil hat Maclaren-Ross an amerikanischen Autoren wie Dashiell Hammett oder Raymond Chandler geschult und als einer der Ersten in die englische Literatur eingeführt, wo sich deren Hard-boiled-Haltung aufs Schönste mit britischem Understatement und schwarzem Humor verbindet, von Joachim Kalka kongenial ins Deutsche übersetzt. Mit knapper, kalkuliert unterkühlter Sprache, scharfem Blick für schräge Typen und abgründiger Situationskomik entsteht auf diese Art ein kleines Sittenbild der Vorkriegsmonate, das kleine Leute im Kampf ums tägliche Überleben zeigt.
Darauf verstand sich dieser Autor selbst. Bei uns bislang so gut wie unbekannt, ist Julian Maclaren-Ross (1912 bis 1964) in der an Sonderlingen und Exzentrikern nicht gerade armen Londoner Gesellschaft seit langem eine Kultfigur: ein Dandy, Lebemann und Bohemien der elenden Jahrhundertmitte, der allen Schrecken von Weltwirtschaftskrise, Weltkrieg und entbehrungsreicher Nachkriegszeit durch Eleganz, verschwenderischen Lebensstil und sehr viel Alkohol begegnete. Sein Habitat waren die Bars von Soho, wo er Hof hielt und die versammelte Partygesellschaft nächtelang durch seine Konversationskunst amüsierte (bevorzugtes Thema: Hollywoodfilme). Sein Zuhause waren ständig wechselnde Hotel- und Frauenbetten (bevorzugte Kategorie: Luxusklasse). Sein literarisches Talent war legendär und wurde von Freunden und Förderern wie Graham Greene oder Evelyn Waugh in höchsten Tönen gepriesen.
Doch sah er sich nur dann veranlasst, davon auch Gebrauch zu machen, wenn die Gläubiger ihm allzu aufdringlich zu Leibe rückten, wenn der nächste Rauswurf aus dem Hotel drohte oder Barkeeper nicht mehr bereit waren, weitere Trinkschulden anzuschreiben. So schrieb er förmlich von der Hand in den Mund beziehungsweise in die Kehle und verfasste bevorzugt Kurzprosa, Hörspiele oder Zeitungsartikel, die schnelles Geld versprachen. "Von Liebe und Hunger" - der Titel, durchaus autobiographisch lesbar, ist ein Zitat von Isherwood und Auden - entstand in wenigen rauschhaften Tagen und Nächten in einer Luxussuite mit Liebhaberin am Bloomsbury Square, bezahlt vom Vorschuss des Verlegers, der täglich an der Tür stand, um den Stand des Manuskripts zu überprüfen. Paul Willett, der zur deutschen Erstausgabe das Nachwort beigesteuert und 2003 eine mitreißende Biographie ("Fear and Loathing in Fitzrovia") veröffentlicht hat, bezeichnet Maclaren-Ross als einen "nachlässigen Treuhänder seiner eigenen Gaben". Das ist zurückhaltend ausgedrückt und zutiefst bedauerlich. Gerade dieser einzige Roman lässt ahnen, was für großartige Panoramen jener wilden Übergangsgesellschaft dieser Autor sonst noch hätte schreiben können. Auch sein Alter Ego Fanshawe - selbstverständlich hat Maclaren-Ross im Roman eigene Erfahrungen als Staubsaugervertreter verarbeitet - plant beständig den ganz großen literarischen Wurf, einen Zeitroman, der zugleich seine Erfahrungen im spätkolonialen Indien, wo er fünf Jahre verbracht hat, verarbeitet wie auch die Erinnerungen an eine verflossene Geliebte, die ihn immer wieder heimsuchen, und kommt doch niemals über Ansätze hinaus.
Große Literatur zehrt oft von der Melancholie großer Werke, die nicht geschrieben werden können. "Von Liebe und Hunger" ist dafür ein zutiefst anrührendes wie zugleich höchst vergnügliches Beispiel.
TOBIAS DÖRING
Julian Maclaren-Ross: "Von Liebe und Hunger". Roman.
Aus dem Englischen von Joachim Kalka. Mit einem Nachwort von Paul Willetts. Arco Verlag, Wuppertal 2015. 328 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
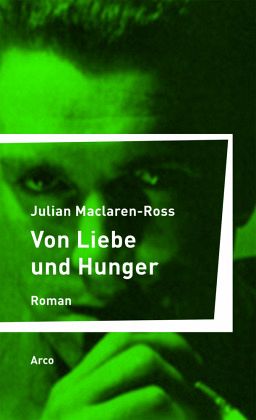




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.07.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.07.2016