solcher Einstellungen entstünde. Es geht also um die Welt der Zeichen und Bilder, mit denen wir uns selbst einordnen und definieren.
Zeiten weltpolitischer Umbrüche, die wir in diesen Jahren vollziehen, werden zu besonderen Belastungsproben für die politische Kultur: Alte Bekenntnisse verlangen nach neuen Begründungen. Das Pathos von gestern wirkt plötzlich schal und abgestanden. Die Fliehkräfte des machtpolitischen Spiels ordnen sich neu. Können die Verankerungen und Einordnungen der Politik noch weiter gültig bleiben? Zeiten des Umbruchs sind Zeiten dramatischer Prüfungen. Der Logenplatz im Zuschauerraum ist plötzlich für jedermann versperrt. Das Drama findet auf der Bühne statt und zieht alle in seinen Sog.
Krockows Buch setzt also an der richtigen Frage an: Was wird aus Deutschland, wenn es wieder seinen Ort zu suchen beginnt - politisch, kulturell, international? Kann der heutige Nationalstaat den Fluch bannen, der über seinem Vorgänger lag? Die richtige Frage wird aber zunächst auf eine falsche Prämisse reduziert: Krockow begreift die deutschen Mythen als die direkten Wegweiser in die Katastrophen. Die Tragödie des 20. Jahrhunderts ist fokussiert in den Mythen, die zum Blick in den Abgrund verlocken.
Wenn aber der Stoff der Politik aus Symbolen und subjektiven Dispositionen besteht, dann ist der Mythos unauflösbarer Bestandteil alles Politischen. Er ist als Orientierungsfilter positiv wie negativ besetzbar. Ohne Mythos gibt es keine Politik. Alles Politische ist mythisch durchwebt. Wer, wie Krockow, das Mythische auf das Katastrophale reduziert, der verkennt das Grundmuster politischer Beziehungen. Dennoch zeigt Krockow, wie man trotz einer solch irreführenden und ärgerlichen Verkürzung ein interessantes Buch schreiben kann. Er reiht die abgründigen, wirkmächtigen Mythen deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts aneinander: eloquent, begriffssicher, gebildet und manchmal mit einem Hauch von Polemik.
Dabei bewegt Krockow im Grunde eine Frage, die wir wirklich überzeugend beantworten müssen: Kann die Demokratie ohne Feindbild überleben? Krockow erklärt den Untergang der Weimarer Republik damit, daß sie "ihrer ganzen Anlage nach ein Staat ohne Feindbild war". Der Wertrelativismus habe so die Aushebelung der Freiheit möglich gemacht. Er richtet nun konsequent die gleiche Frage an das heutige Deutschland. Nachdem für ihn das Feindbild der kommunistischen Bedrohung ursächlich für Aufstieg und Erfolg der Bonner Republik war, gilt nun die Nagelprobe der Demokratie in einer Zeit ohne Gegner. "Wohin nun mit dem trostlos ungestillten Utopiebedürfnis?" Damit kündigen sich neue Gefahren an. Zweifel am Profil der politischen Kultur sind unangebracht. Aber rechtfertigt das die Krockowsche Reduzierung auf zwei radikale, dramatische Alternativen: Rückkehr des Mythos vom Feind und vom Tod oder Verteidigung der Freiheit?
Das Arsenal der deutschen Selbstbilder hält mehr bereit als zwei antagonistische Positionen. Das Problem der politischen Ortsbestimmung Deutschlands entzieht sich einfachen Beschreibungsvermerken. Nie haben die Deutschen aufgehört, die Frage nach sich selbst zu stellen - und sie haben viele Antworten zu ihrem Standort gegeben: Westwendung und Ostorientierung, das Bewußtsein von Sonderweg, von Mittellage, Vorstellungen von einer Vermittlerrolle zwischen Ost und West und der Traum von einem anderen Deutschland als geistiger Möglichkeit. Unterschiedliche Traditionslinien verlaufen nebeneinander; versunken geglaubte Bilder tauchen wieder auf, erhalten neue Prägekraft. Immer wieder lockt die magische Kraft der politischen Romantik. Ein scheinbar überraschender Wechsel des kulturellen Klimas erweist sich bei näherem Hinsehen als bloße Vergegenwärtigung von Erinnerung. Welches der vielen Bilder künftig die Oberhand gewinnen wird, das entscheidet sich im politischen und intellektuellen Streit. Die Deutschen haben mehr als nur die zwei Optionen für ihre Zukunft, die Krockow vorgibt. WERNER WEIDENFELD
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
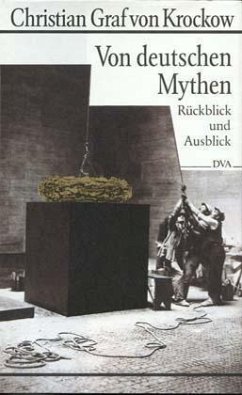




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.09.1995
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.09.1995