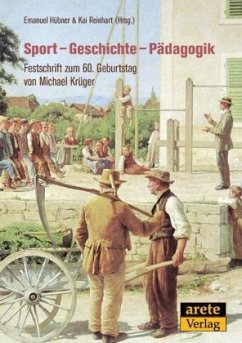zwanzigsten Jahrhundert. Die Anfänge bis zum achtzehnten Jahrhundert standen aus. Auch der neue Band eignet sich für Studenten, Lehrer und für die Mitglieder von Sportvereinen, Ruderer, Judokämpfer, Tennisspieler.
Die edlen Ritter maßen ihre Kräfte und Tugenden nicht beim Volleyball, weshalb dieses heute beliebte Spiel im ersten Teil nicht vorkommt. Dafür wird das kretische Stierspringen erwähnt, das glücklicherweise heute nicht mehr praktiziert wird, weil dabei viele Jugendliche ihren Tod auf den Hörnern des Stieres gefunden haben sollen. Im modernen Stierkampf, der noch nicht abgeschafft ist, sind die Chancen anders verteilt: Hatte in Kreta der Mensch vor dem Stier kaum eine Chance, so sieht es für den Stier vor dem Menschen in Spanien übel aus. Der Sport ist für den Menschen im Zeitalter der Hausratversicherung sicherer geworden: ein Wettkampfspiel.
Krügers Sportgeschichte kommt im Trainingsanzug eines Einführungsbandes daher. Erwarte also keiner eine reichillustrierte und in ihren Thesen aufregende Darstellung des sportlichen Verlangens. Krüger spielt sich vor dem Einband nicht unnötig auf, er referiert, was das Fach in seinen Wissensgrundzügen zusammenhält. Hier wird nicht gedribbelt, sondern das Zuspielen praktiziert. Darunter finden sich kleine Funde für Laien. Der eine Fund stammt vom Norweger Karl Lumholtz, der in der Wende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert in Mexiko herumreiste. Er berichtet, daß Tarahumara-Indianer rund 273 Kilometer ohne Unterbrechung im Dauerlauf zurücklegen. Sie nähmen nur geröstetes Maismehl und Wasser zu sich. Die Läufer trainieren nicht, erzählt der erstaunte Norweger, da sie ja ohnehin täglich hierhin und dorthin rennen. Einschub: Die Not macht also nicht nur erfinderisch, sondern auch tüchtig. Doch würden sich die Indianer an strenge Fastenvorschriften halten, kein Fett, keine Eier und keine Süßigkeiten essen und auch nicht mit den Frauen Beischlaf pflegen. Das Resultat kann sich sehen lassen.
Dem sportlichen Körpereinsatz hing über die Jahre hin der Blutgeruch des Überlebenskampfes an. Wer durchtrainiert war, der konnte dem Feind ruhiger in die kalten Augen sehen, bevor er ihn erschlug. Erst seit dem Mittelalter und der Reniassance gehörte die Körperertüchtigung zur Ausbildung eines galanten Mannes, der nicht auf Schritt und Tritt mit Pfeil und Bogen durch die Gemächer schleichen mußte. Der Ritter sollte in Frieden schwimmen, tauchen, reiten, ringen, fechten, jagen, tanzen können. Eine Palette von Fähigkeiten macht den Mann.
Diese ganzheitliche Leibesausbildung verlepperte sich mit den Jahren. Heute verbringen viele Menschen einen großen Teil ihrer Lebenszeit damit, vor dem Fernseher zu sitzen und aktiven Körperexperten, Fußballern, Schwimmern, Radfahrern und Tennisspielern, bei der Ausübung ihrer beschränkten Fähigkeiten zuzuschauen. Das ist traurig. Die Sportberichterstattung fängt diese Beschränkung unterderhand auf, indem sie von den unterschiedlichen Disziplinen berichtet. Dadurch entsteht manchmal am Abend eine Ahnung vom Rittertum. Eine Ahnung, die rasch verweht unter den Flüchen und Tiraden, mit denen die Gewinner und Verlierer von den Zuschauern überzogen werden, als würden die Zuschauer nicht vor dem Fernseher, sondern im Kolosseum sitzen und über die Gladiatoren befinden.
In Krügers Einführung findet sich auch das Bild eines Watussi, der über einen sehr hoch gelegten Stock springt. Das Foto stammt aus dem Jahr 1908. Auf dem Foto ist Herzog Anton Friedrich von Mecklenburg zu sehen, was auf den ersten Blick nicht einleuchtet. Der Stock, über den der Watussi springt, soll in einer Höhe von 2,53 Meter gelegen haben. Der Sprung des Watussi wurde durch den Bericht des Herzogs bekannt. Der Herzog saß in den Jahren 1912 bis 1914 als Gouverneur in der deutschen Kolonie Togo und kam auf seinen Reisen auch nach Ruanda, wo der Stamm der Watussi jagte und sprang. Dabei fällt einem ein: Wie viele Rekorde sind nicht schon im Busch und im Dunkel der Geschichte erzielt und gebrochen worden, ohne daß ein Sportkommentator davon Kenntnis genommen und sie verzeichnet hätte.
Unschlagbar bleibt unsere Zeit auf dem Feld der Ausstattung: Der schnelle Sportschuh führt zum Sieg. Auf einem Foto in Krügers Buch sind einige Krahó-Indianer aus dem Nordosten Brasiliens beim Klotzrennen zu sehen. Die Indianer sind so gut wie nackt. Man kann sich die Zoten aus dem Munde der Zuschauer vorm Fernseher vorstellen. Wie es aber kam, daß Fotografien und Berichte aus der Zeit der Wende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert Eingang fanden in eine Geschichte des Sports von den Anfängen bis zum achtzehnten Jahrhundert - das wissen wir leider nicht.
EBERHARD RATHGEB.
Michael Krüger: "Einführung in die Geschichte der Leibeserziehung und des Sports". Band 1: Von den Anfängen bis ins achtzehnte Jahrhundert. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf 2004. 248 S., einige Abbildungen, br., 29,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
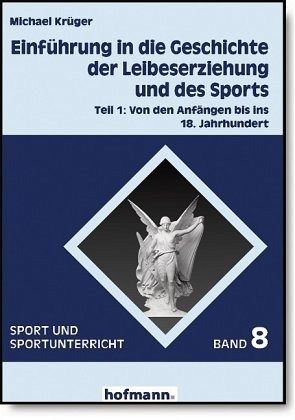




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2004