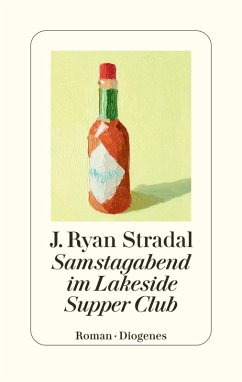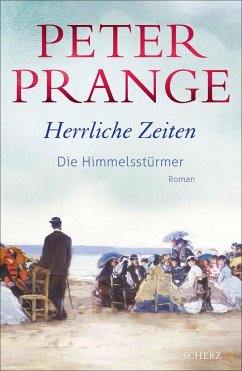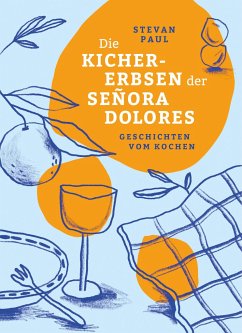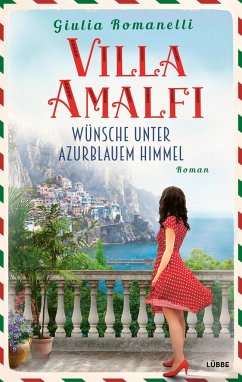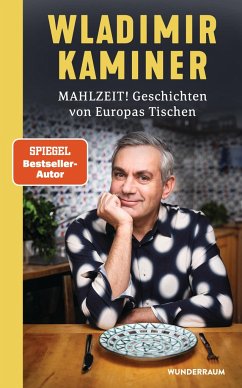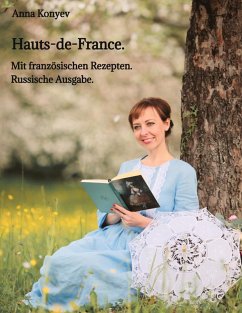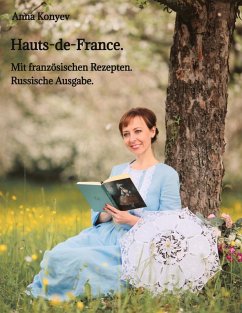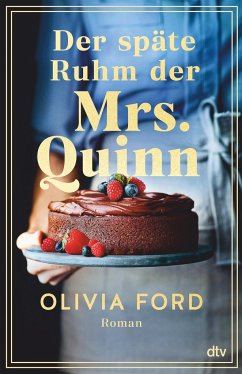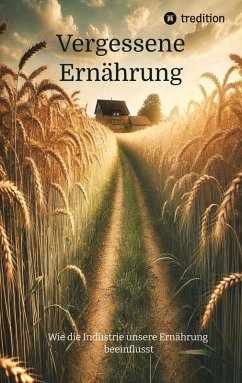und das auch nur dann, wenn man mit allen fünf Motoren fuhr. Die Herausforderung war umso größer, als es galt, eine anspruchsvolle Kundschaft zufriedenzustellen: "Offiziere, Millionäre, Presseleute und sonstige Feinschmecker", wie der amtierende Luftschifffahrtsküchenchef in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1932 vermerkte.
Einige Hundert Meter unter den Wolken hatte man zwar viel Platz, dafür aber keinen englischen Staudensellerie, geschweige denn Forelle oder Rehrücken. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg herrschte in den Esszimmern eine heute fast unvorstellbare Not. Selbst die Mittelschicht musste sich oft mit Wassersuppe und trockenen Kartoffeln begnügen. Hoch im Kurs standen Kochbücher, die mit dem Signalwort "ohne" warben: Mehlspeisen ohne Ei, Torten ohne Fett, Mittagstisch ohne Fleisch und so fort. Helene Reitters "Kochbuch für fleischlose Kost" (1915) nahm Jahr für Jahr an Umfang zu und erschien 1919 unter dem Titel "Kochbuch für fleischlose, fettlose und eiersparende Kost".
Der Wiener Literatur- und Kulturwissenschaftler Walter Schübler hat deutschsprachige Zeitungsartikel und literarische Vignetten zusammengetragen, die sich mit den Freuden, Tücken und Wirren der Nahrungsaufnahme in der Zwischenkriegszeit befassen. Entstanden ist eine heterodoxe Geschichte Mitteleuropas im Prisma der Essgewohnheiten und kulinarischen Präferenzen. Von der Gier nach Schlagsahne, die als "Ding gewordener weißer Friede" in den von kriegsrechtlichen Verzichtsreglements ermatteten Deutschen den Trieb zur Ungesetzlichkeit weckte, bis zur terminologischen Gleichschaltung des "Eintopfgerichts", das in den Kochbüchern vor 1933 noch "Mischgericht", "Zusammengekochtes" oder "Durcheinander" hieß, spannt sich der Bogen.
Wer Sinn hat für das kulinarische Hintergrundrauschen der Weltgeschichte, wird reich beschenkt, denn es ist ein Lesebuch im besten Sinne, abschweifend, informativ, anregend. Der Alltag der Zwanziger- und Dreißigerjahre wird sozial- und kulturgeschichtlich in einer Genauigkeit kartographiert, wie es selbst den guten wissenschaftlichen Monographien kaum gelingt. Freilich schadet es nicht, wenn der Leser, der nicht nur unterhalten sein will, vor oder während der Lektüre die eine oder andere Gesamtdarstellung zur Hand nimmt. Zwar enthält jedes der dreißig Kapitel am Ende eine erläuternde "Glosse" des Herausgebers, aber diese sind von sehr unterschiedlichem Gehalt und dürften den Wissensdurst jedenfalls derer, die über keine vertieften Vorkenntnisse verfügen, nicht stillen, zumal ein nicht geringer Teil der edierten Texte aus der Feder österreichischer Autoren stammt, die sich in ihren Zeitdiagnosen vornehmlich auf die spezifischen Verhältnisse in der havarierten Donaumonarchie beziehen.
Auffallend reich ist das Buch an vergangener Zukunft, an gescheiterten Rationalisierungs- und Modernisierungsprojekten wie den zeitweise so populären wie verrufenen Automatenrestaurants, in denen Bankrotteure und Huren sich rund um die Uhr für zehn Kreuzer Kaviar und einen Manhattan-Cocktail ziehen konnten.
Überhaupt ist erschütternd, wie unmodern wir in unserem Homeoffice-Biedermeier geworden sind. In Schnellrestaurants gab es damals eine Art "Super Fast Lane", einen separaten Bereich in Gestalt von "Eiltischen" für Gäste, denen es nicht schnell genug gehen konnte. Und wer Avocados für den letzten Schrei hält, der sollte vielleicht mal vom japanischen Teepilz kosten, der mit Tee und viel Zucker übergossen und einige Tage der Gärung überlassen wurde. "Kombucha" war vor einhundert Jahren das "Superfood" schlechthin. Jeder Haushalt hege und pflege heute seinen Teeschwamm, um alle nur denkbaren Krankheiten zu heilen, heißt es in einem Artikel von 1928, doch werde dieser "Kochbuchrummel" vermutlich "so bald verklingen, wie er plötzlich gekommen ist". Auch alles Essbare musste eben neu, schnell und extravagant sein. Zuckerbäcker wie Bernhard Lambrecht - "der Lenin der Tortenwelt" - übertrugen die Gestaltungsprinzipien des Bauhauses auf die Konditoreikunst und veröffentlichten Manifeste, in denen sie aus Kuvertüre und Zuckerguss gefertigten "nackten Frauengestalten, Schlangen, Raubvögeln, Tischlampen und was der unmöglichen Dinge mehr sind" den Kampf ansagten.
Dem frühen 21. Jahrhundert mindestens ebenbürtig war man in der Disziplin, ernährungs- und gesundheitspolitische Kampagnen in den Sand zu setzen, weil die betroffenen Ressorts gegenläufige Ziele verfolgten. Während das Landwirtschaftsministerium sich seit Jahren bemühte, den Milchkonsum in Deutschland "zur Förderung der Volksgesundheit" zu heben, erklärte das Reichsfinanzministerium "zur Förderung der Einnahmen" das "Mineralwasser-Steuergesetz" von 1930 kurzerhand auf Schokoladenmilch anwendbar. Dagegen protestierte die gemeinnützige Stuttgarter Milchversorgung G.m.b.H., die zu bedenken gab, dass Schokoladenmilch keinerlei Ähnlichkeit mit Mineralwasser aufweise und die richtige Bezeichnung für eine Steuer, die alle Getränke erfasse, Getränke- und nicht Mineralwassersteuer sei. Selbstverständlich drang das Unternehmen mit seinen abwegigen Argumenten nicht durch. Schokoladenmilch verteuerte sich um mehr als dreißig Prozent und konnte fortan keinen Beitrag mehr zur Volksgesundheit leisten.
An Amuse-Gueules dieser Art besteht in Schüblers Band kein Mangel. Nicht auf ihre Kosten kommen allein diejenigen, die dem Buch Anregungen für ein opulentes Souper entnehmen möchten, wie es ehedem Talleyrand oder Cambacérès ausrichteten. Die Zwanziger- und Dreißigerjahre waren nämlich anders als das frühe neunzehnte Jahrhundert kein goldenes Zeitalter der Haute Cuisine. Dafür stand der Journalismus in seiner Blüte, was vielleicht wichtiger ist, denn auch für kulinarisch interessierte Leser sollte die von Schübler kredenzte essayistische Feinkost eines Kurt Tucholsky, Walter Benjamin, Alfred Polgar und Siegfried Kracauer der größte Genuss sein. DANIEL DAMLER
Walter Schübler: "Vom Essen zwischen den Kriegen".
Edition Atelier, Wien 2024. 360 S., Abb., geb., 35,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
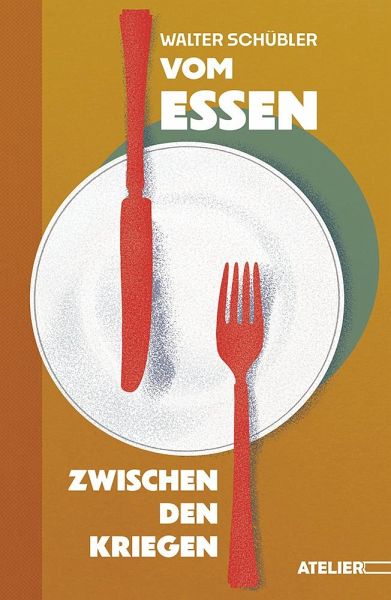





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.05.2024
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.05.2024