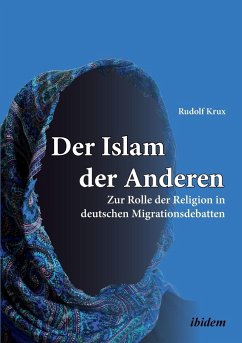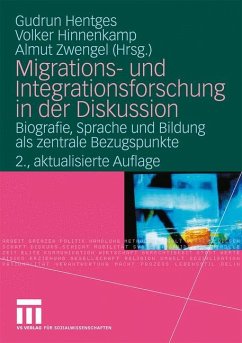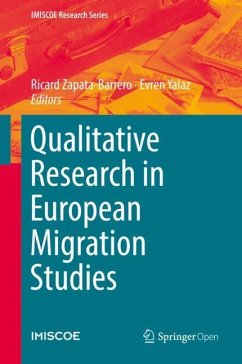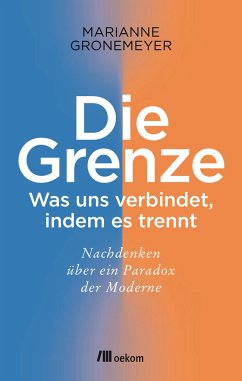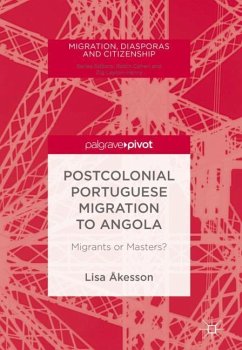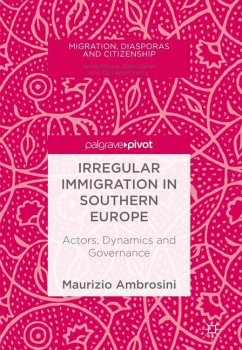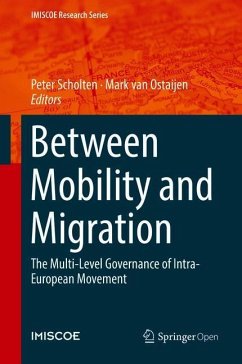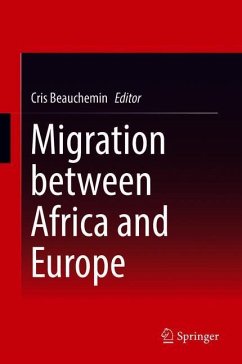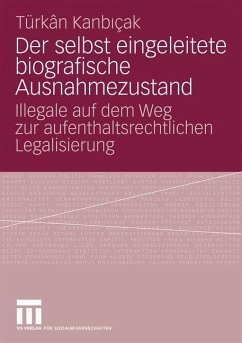Autoren auch damit kokettieren, dass sie deutsche Nachnamen haben, aber wir wollen nicht vorgreifen.
Der Name, der den Saal so gut gefüllt hat, dürfte der des eingeladenen Diskussionsgasts sein. Es ist Thilo Sarrazin, "Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor". Sarrazin, der vor drei Tagen bei einer Lesung in Düsseldorf knapp einem Tortenanschlag entging, liefert im Lauf des Morgens auch ein paar Kracher, wie man es von ihm erwarten darf. "Man kann Gerechtigkeit in der Welt nicht in Europa herstellen." Oder: "Siebzig bis achtzig Prozent der neuen Migranten werden auf viele Jahre hinaus von der deutschen Sozialhilfe leben." Die Welt wird einfacher mit diesem Ratgeber. Zunächst aber tut Sarrazin etwas geradezu Braves, mit dem angeschwollenen Ton seiner Bestseller ("Deutschland schafft sich ab", "Der neue Tugendterror", "Wunschdenken") kaum Vereinbares: Er referiert knapp den Aufbau des in Rede stehenden Buches und merkt an, welche Thesen darin er teilt (fast alle) und welche nicht (Kleinigkeiten).
Doch nicht alle anwesenden Journalisten haben die neunzig luftig gedruckten Seiten von "Völkerwanderung" schon gelesen, das ist spürbar. Hätten sie es, wäre ihnen der Kontrast zwischen der apodiktischen Schärfe des Buchs und dem völlig unkämpferischen Auftreten der Autoren aufgefallen. Klaus, knapp 75 Jahre alt, hat etwas Großväterlich-Verschmitztes, das anschmiegsam auf der Haut des knallharten Politikers sitzt. Er spricht Deutsch, während Weigls Rolle sich darauf beschränkt, zweimal etwas auf Englisch einzuwerfen. Ansonsten vertrauen die alten Kampfgefährten auf die Macht ihrer Thesen.
Und die sollte man sich direkt aus dem Buch selbst zuführen, das Klaus als "Fibel" auffasst, als kürzestmögliche Erklärung der gegenwärtigen Flüchtlingskrise. Darunter zum Beispiel folgende: Die letzte Massenmigration eines solchen Ausmaßes habe vor 1500 Jahren den Untergang des Römischen Reiches bewirkt. Individuelle Migration sei hinnehmbar, Massenmigration nicht. "Der westliche Versuch, die Demokratie in den Nahen und Mittleren Osten zu exportieren, ist offensichtlich gescheitert." Europa benötige so viele Migranten nicht, weder aus demographischen noch anderen Gründen. Vielmehr sei es andersherum: "Die Massenmigration wird das bisherige Gleichgewicht der europäischen Gesellschaft ins Wanken bringen." Europa schafft sich ab! Schuld daran seien die "Eliten" in Berlin, Paris und Brüssel. Und: Es handele sich mitnichten um einen "Konflikt zwischen Altruismus und Xenophobie". Der Ökonom, der Václav Klaus auch ist, verlässt sich auf seinen Befund.
Nützt das? Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Tortenwerfen hilft ja nicht. Eher spricht manches dafür, dass sich die bundesdeutsche Gesellschaft diesen Gedanken noch nicht oder nur in verdruckster Form gestellt hat, als reflexhafte Abwehr von AfD-Thesen. Angesichts deren brauner Ränder mag das verständlich sein, aber die Probleme löst das nicht. Der Eiertanz darum, ob man von "Obergrenzen" oder "Kontingenten" sprechen dürfe (und warum dann doch nicht), hat eine andere Kluft zugebaut: dass es zwischen hochherziger Privatethik ("Willkommenskultur") und der Aufnahmefähigkeit der Sozialsysteme (Wie viele Migranten können wir verkraften? In welcher Zeit? Und was kostet die Integration?) mit fortschreitender Zeit immer weniger Schnittmenge geben wird.
Ein weiterer Umstand legt nahe, Klaus' Reflexionen als produktives Störfeuer im europäischen Konsenspalaver zu betrachten: Sie repräsentieren wohl das Denken immer größerer Teile des europäischen Ostens. Dessen historisches Gedächtnis führt immer wieder zum Diktat der Sowjetzeit zurück und lässt die Zeit des Träumens, nach dem Mauerfall, allzu kurz erscheinen. Ironischerweise kehrt das Friedens- und Einheitsversprechen der Europäischen Union in dieser Lesart heute als Karikatur seiner selbst wieder, als betonhafter Büttel aus Brüssel. Es dürfte also wenig helfen, die Merkel-Kritiker (Ungarn, Polen) als Außenseiter zu brandmarken und ohne Erklärungen mit dem Durchregieren fortzufahren. Vielleicht ist es an der Zeit, sich nicht nur mit der AfD, sondern auch mit einer ideellen AfE (Alternative für Europa) zu beschäftigen und ihre Argumente mit Argumenten zu beantworten.
Dass diese Diskussion auch in Zukunft schwerfallen wird, dafür sorgen die Autoren allerdings selbst, und zwar mit flächendeckender politischer Paranoia. Der Mainstream, schreiben sie, "verkörpert durch Bundeskanzlerin Merkel und Parteipolitiker aller Couleur, folgt durchweg dem linken Progressivismus, dem umfangreichen Etatismus und Staatspaternalismus, dem grünen Dirigismus und einem extensiven sozialen Konstruktivismus". Das dürfte auf Tschechisch genauso mehlig klingen. Auch Genderpolitik, Multikulturalismus und die Bürgerrechte sexueller Minderheiten fliegen mit in den großen Topf des Ressentiments, was nicht schlecht zum Berliner Verlag Manuscriptum passt, der schon in der Vergangenheit durch sektiererische Veröffentlichungen zum Sexualbewusstsein der Deutschen aufgefallen ist. Kein Wunder, dass Václav Klaus bei der Gretchenfrage des Morgens keine Sekunde zögerte: "Die AfD hat zum Migrationsthema bessere Antworten als alle anderen deutschen Parteien."
Der Zufall will es, dass bei C. H. Beck gerade "Die neue Odyssee: Eine Geschichte der europäischen Flüchtlingskrise" (F.A.Z. vom 27. Mai) erschienen ist, die Reportagensammlung des Briten Patrick Kingsley. Vermutlich würde Václav Klaus schon über die Berufsbezeichnung des Autors lachen: Kingsley, 27 Jahre alt, ist Migrationskorrespondent des britischen "Guardian". Das Buch stützt sich auf Recherchereisen im vergangenen Jahr (rund hundert Flüge, 17 Länder, drei Kontinente) an die Brennpunkte des Migrationsdramas. Auch Kingsley schreibt, wie Klaus, von "Politikern, die wegschauen". Aber seine Schlussfolgerung ist radikal entgegengesetzt: Er fordert nicht weniger europäisches Engagement, sondern mehr - besseres, nachhaltiges Engagement. Und indem er seinem Protagonisten, einem vierzigjährigen Syrer, Namen, Aussehen und Stimme gibt, fordert er von seinen Lesern, dem Flüchtlingselend ins Gesicht zu blicken. "Wir schaffen das", dieser Satz war wohl von Anfang an eine Erinnerung an den moralischen Maßstab, der Europäern vor Augen stehen könnte. Nicht allen, nicht überall. Aber doch vielen und seit sehr langer Zeit.
Ebendeshalb wird man das große Wegschauen des ehemaligen tschechischen Präsidenten in "Völkerwanderung" ausbuchstabieren müssen. Václav Klaus' Rezepte sind isolationistisch und auf den Nationalstaat fixiert. Reale Menschen kommen in seiner kalten Geschichtslektion nicht vor, die Globalisierung auch nicht. Jugendkultur, Liberalismus, Kosmopolitismus und die für den Westen so typische Durchmischung der Lebensstile sind ihm ein Graus. Das ist sein gutes Recht. Doch sein neues Europa der Abschottung wirkt dann doch ziemlich alt. Steinalt.
PAUL INGENDAAY
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
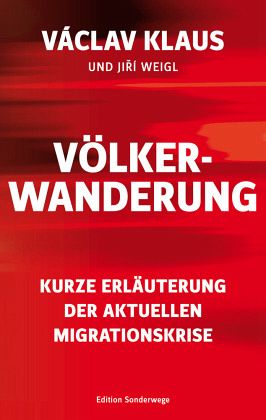




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.06.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.06.2016