ist?
Joey Goebel aus Henderson in Kentucky hat das gar nicht nötig. Was er übers Musikgeschäft schreibt, setzt nicht zwingend eigene Erfahrung voraus, sondern solide Recherche, und wie er seine Geschichte erzählt, das hat weniger mit Punkrock zu tun als mit bestimmten erzählerischen Techniken, die er auf dem College und natürlich durch die Lektüre von Romanen erlernt hat.
Sein zweiter Roman "Vincent" - der im Original "Torture the Artist" heißt - ist ein Buch, das sich schon deshalb gut liest, weil es von einer Welt erzählt, deren Benutzeroberfläche jeder aus Fernsehen und yellow press kennt, und das ein wenig zu lang geraten ist, weil es irgendwann keinen Ausweg mehr aus dem Szenario findet, in das es sich selber kopfüber und mutig hineinbegeben hat. Goebels Idee ist überzeugender als die Mittel, sie in eine schlüssige Erzählung zu verwandeln, und deshalb werden seine Charaktere mit fortschreitender Handlung auch immer blasser und langweiliger. Das nimmt einen zwar für die Idee ein, aber schließlich fragt man sich doch, ob sie wirklich so gut war.
"Vincent" entwickelt eine amerikanische Vorstellung vom Künstlerleben aus der Retorte. Ein inzwischen moribunder Medientycoon hat die Welt mit Billigware überschwemmt: Songs, Fernsehserien, Filme, Bücher. Als Akt tätiger Reue ruft er ein Projekt namens "New Renaissance" ins Leben. Und weil er überzeugt ist, daß wahre Kunst nicht ohne Leid des Künstlers entstehen kann, soll den Hochbegabten ihr Leben zur Hölle gemacht werden, damit die Kultur nicht endgültig im Seichten ertrinkt, obwohl der einstige RTL-Chef Helmut Thoma ja behauptet hat, das sei gar nicht möglich. Ein ehemaliger Musikkritiker und Verlierertyp namens Harlan wird angeheuert, um das Wunderkind Vincent Spinetti, dessen Hang zur Selbstzerstörung der Vorname andeuten soll, per aspera ad astra zu führen, indem er etwa den Hund vergiftet und Freundinnen gegen Bares dazu bringt, das junge Genie sofort wieder zu verlassen, damit es sein Leiden zur Kunst sublimiert. Wobei Kunst in diesem Falle heißt, anständige Songs, Film- und Fernsehdrehbücher zu schreiben, anstatt alteuropäisch Bilder zu malen, Sinfonien zu komponieren oder Gedichte und Romane zu verfassen.
Goebels Entschluß, den haltlosen Harlan dabei als Ich-Erzähler einzusetzen, um ihn die alte Formel "private vices, public benefits" exekutieren zu lassen, ist eine sinnvolle Strategie, weil die Aufgabe, vierhundert Seiten im Kopf eines traumatisierten Wunderkindes aus total dysfunktionaler Familie zu verbringen, wohl auch erfahrene Autoren überforderte. Harlan ist ein guter Führer durchs Gewerbe: zynisch, ohne unangenehm zu sein, skrupulös genug, um glaubwürdig zu bleiben. Und Harlans bestes Stilmittel als Erzähler ist es, alle auftauchenden Personen einer prägnanten Kurzvorstellung zu unterziehen: Er zählt einfach ihren Lieblingsmusiker, ihre Lieblingsfernsehserie und ihren Lieblingsfilm auf.
Das Problem des Romans fängt dort an, wo die Tiraden, Sottisen und Tobsuchtsanfälle gegenüber den Mainstream-Produkten der verschiedenen Sparten aufhören - dann muß etwas kommen, was sie mühelos überstrahlt, was das Kunstprädikat verdient und einen zwar nicht an den Masterplan des Tycoons glauben läßt, aber zumindest daran, daß Vincents Produkte wirklich eine subversive Qualität haben und nicht bloß die langweilige Kehrseite jener beliebten Kulturkritik sind, welche gebetsmühlenartig Kommerzialisierung, Verflachung und Verblödung beklagt und sich gar nicht mehr die Mühe macht, die Belege dafür zu präsentieren.
Genau da gerät der Roman ins Schlingern. Was als Satire auf den Medienbetrieb angelegt ist, ist nicht grell, auch nicht spielerisch genug, und was Vincents kummer- und leidgeborene Werke dem entgegensetzen, ist wiederum auch nicht so, daß es als Rettung vor dem angeblich so geistlosen Mainstream überzeugte. Das liegt nicht nur daran, daß die Therapiemaßnahme des Tycoons sich derselben Mittel bedient, welche die von ihm diagnostizierte Krankheit ausgelöst haben; es liegt vor allem daran, daß Goebels Frontalangriff nicht gerade originell ist. Die Mächtigen im Gewerbe, die Senderchefs, Rechtsanwälte und Stars, sind eher mäßige Karikaturen und Projektionen eines vagen Ressentiments gegenüber der Unterhaltungsindustrie. Man erkennt auch die eine und den anderen, man denkt an J. Lo. und Sly Stallone, aber sonderlich subtil sind diese Parodien nicht ausgefallen.
Und wenn Vincent dann ins Sündenbabel Los Angeles zieht und Harlans Unbehagen an dem, was er ihm im Dienste der Kunst angetan hat, sich in Selbstmitleid verwandelt, ist Joey Goebel endgültig die Luft ausgegangen. Aus Intrigen werden mafiose Strukturen, aus Manipulationen Morde, und der Plot, welcher einen mit seiner charmanten Prämisse und seinen kleinen Skurrilitäten fast dreihundert Seiten lang ziemlich gut unterhalten hat, mündet in ein Finale, das denselben Mainstream-Rezepten folgt, welche die Helden vorher so erbittert bekämpft haben.
PETER KÖRTE
Joey Goebel: "Vincent". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Hans M. Herzog und Matthias Jendis. Diogenes Verlag, Zürich 2005. 434 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
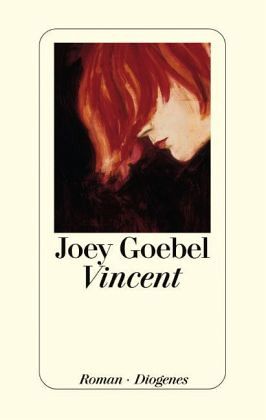





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.11.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.11.2005