Nicht lieferbar
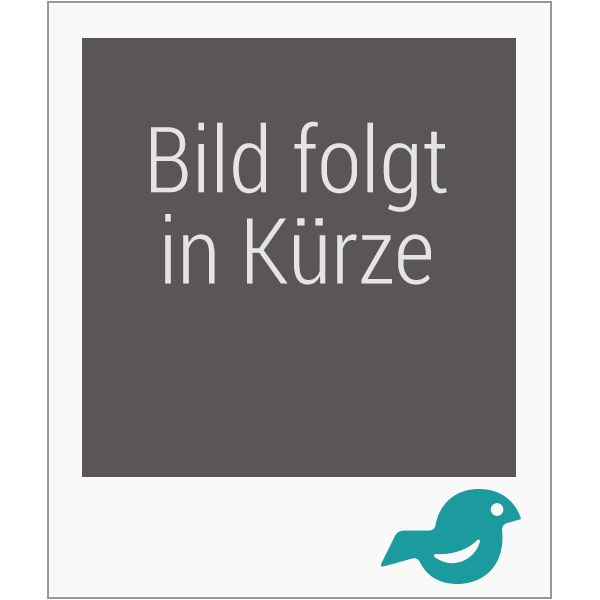
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




Die Untersuchung befaßt sich mit dem Lesen im Neuen Testament. Sie geht den 'Lese-Stellen' im einzelnen nach, stellt den Zusammenhang von Lesen und Verstehen dar und arbeitet verschiedene Lesemodelle heraus. Das Neue Testament wird dabei in den Rahmen der antiken Lesekultur hineingestellt. Darüber hinaus wird das Gespräch mit der gegenwärtigen Literaturwissenschaft gesucht. Bemerkungen über den aktuellen Bibelgebrauch runden die Untersuchung ab.
Produktdetails
- Verlag: WBG Academic
- 1994.
- Seitenzahl: 241
- Deutsch
- Abmessung: 13mm x 135mm x 214mm
- Gewicht: 302g
- ISBN-13: 9783534123841
- ISBN-10: 3534123840
- Artikelnr.: 05310030
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.1995
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.1995Der Teufel führt auf der Kuhhaut Buch
Peter Müllers Studie über Lesen und Verstehen in der Welt des Neuen Testaments
"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" - dieser Satz ist den meisten Zeitgenossen als Reklame für Mon Chéri bekannt. Er ist jedoch, wie man sich vielleicht belehren lassen darf, mehrbödig, zunächst einmal ein Zitat, näherhin eines aus dem Neuen Testament (Matthäusevangelium), das ihn selbst wiederum aus dem Alten Testament (5. Buch Mosis) zitiert. Und außerdem zielt der Satz in seiner zweiten, zumeist nicht zitierten Hälfte ("sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt") auf den gesamten Bereich von Sprache, Wort, Schrift, Buch, Gesetz und Schriftauslegung, und um den geht es in dem Buch
Peter Müllers Studie über Lesen und Verstehen in der Welt des Neuen Testaments
"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" - dieser Satz ist den meisten Zeitgenossen als Reklame für Mon Chéri bekannt. Er ist jedoch, wie man sich vielleicht belehren lassen darf, mehrbödig, zunächst einmal ein Zitat, näherhin eines aus dem Neuen Testament (Matthäusevangelium), das ihn selbst wiederum aus dem Alten Testament (5. Buch Mosis) zitiert. Und außerdem zielt der Satz in seiner zweiten, zumeist nicht zitierten Hälfte ("sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt") auf den gesamten Bereich von Sprache, Wort, Schrift, Buch, Gesetz und Schriftauslegung, und um den geht es in dem Buch
Mehr anzeigen
des Karlsruher Religionspädagogen Peter Müller, und zwar im Sinne von Lesekultur und Lesegemeinschaft rund um die Bibel.
Bei uns freilich meinen die meisten (55 Prozent), sie kennten die Bibel schon, da sie Sprüche von der Art des oben genannten sowie Aufforderungen zu Tugendhaftigkeit enthalte, und brauchten sie daher nicht mehr zu lesen. Das heilige Buch ist heute Überrest einer Lesekultur, die zu den Fermenten unserer Kultur überhaupt gehört. Das Stadium der Schriftlichkeit stellt dabei nur eine Zwischenstufe dar, vermittelnd zwischen Akten des Lebens, genannt Produktion und Rezeption, sowie zwischen Autor oder Übersetzer und Empfänger. An der Schnittstelle zwischen Schriftlichkeit und neuer Aufnahme oder Umsetzung steht das Lesen.
In der Antike und auch im Umkreis der Bibel, in der fremden Lesekultur also, von der Müller berichtet, ist Lesen immer lautes Vorlesen, oft von Sklaven vor ihren Herrinnen und Herren; daher ist noch heute das römische Brevier von den Klerikern nicht still zu lesen, sondern wenigstens halblaut zu murmeln. Anders als bei uns ist damals nicht die Verschriftlichung, sondern das Vorlesen der eigentliche Akt der Veröffentlichung und Weitergabe. Alles Schriftliche zielte nicht auf den stillen Leser, der sich "mit seinem Buch zurückzieht", sondern auf die Erbauung oder den Aufbau einer Gemeinschaft.
In der Antike war Schriftliches zunächst und zumeist in Rollenform gestaltet, wobei die rechte Hand die Rolle hielt, die linke sie am unteren Ende entfaltete und das Ganze nach der Lektüre neu umgekehrt aufgerollt werden mußte. Die frühen Christen hatten dagegen schon früh die Vorzüge der Kodexform erkannt - für den Kodex aber konnte man nur Pergament verwenden. Im Unterschied zur Papyrusrolle waren die Seiten des aus Tierhäuten hergestellten Pergamentkodex doppelseitig beschreibbar. Auch ließen sich so für den gottesdienstlichen Gebrauch Textstellen leichter finden.
Die Verlesung stellt den heiligen Text, wie Müller zeigt, in einen jeweils neuen Kontext, und schon allein dadurch wird er stillschweigend oder ausdrücklich je neu gedeutet. Diese Deutung ist immer auch Auslegung: der Ursprung der Predigt. Zudem hatte man sich zur Zeit Jesu schon lange daran gewöhnt, daß die Juden auch in Palästina das alte Hebräisch nicht mehr verstanden. Ein Übersetzer trug eine aramäische Version in der herrschenden Volkssprache vor, eine oftmals deutlich erweiterte Neufassung des Textes.
Die von protestantischen Pastoren aufgrund eigener Erfahrung so genannte "Antrittspredigt" Jesu in Nazareth nach dem vierten Kapitel des Lukasevangeliums schildert Jesus bei just einer derartigen Auslegung in der Synagoge seiner Vaterstadt. Da Jesus die vorgelesene Jesajastelle kühn auf sich selbst hin deutet, ist für Lukas fortan der Grundsatz legitimiert, daß die Bibel - und für Lukas ist das noch das Alte Testament - auf Jesus hin ausgelegt werden könne. Bei dieser Art Auslegung leisten sich freilich die Verfasser des Neuen Testaments freche Veränderungen des Ausgangstextes, die spätere Gewaltsamkeiten der Deutung als geradezu harmlos erscheinen lassen. So zitiert der Evangelist Matthäus den Propheten Micha: "Und du, Bethlehem, bist die geringste unter den Führungsstädten Judas." Matthäus verbessert: "Und du, Bethlehem, bist keineswegs die geringste unter den Führungsstädten Judas", denn es durfte ja nicht sein, daß Bethlehem gering genannt worden war. Freilich liegen solche Verbesserungen des Sinnes ganz im Rahmen des damals im Judentum und in der Rhetorik Üblichen, und es gab etablierte Regeln, nach denen der Wortlaut der Schrift den Erfordernissen anzupassen war.
Nicht nur die gegenwärtige Verkündigung ist je und je ein Akt des Verlesens, auch bei der Wiederkunft Christi wird es eine Rolle spielen. Dann freilich wird aus den Büchern vorgelesen, die jetzt im Himmel geschrieben werden und die Taten der Menschen verzeichnen. Nach dem späten Mittelalter führt parallel auch der Teufel Buch, und er registriert, konservativ wie er ist, auf dem altertümlichen Schreibmaterial der Kuhhaut so viele Sünden, daß es auf keine Kuhhaut geht.
An die Stelle apokalyptischer Bilder treten in unseren Tagen etwas farblosere Theorien, die dem Akt des Lesens auf der Spur sind und kriminalistisch genau zwischen implizitem und informiertem Leser, zwischen gedachtem und Modell-Leser unterscheiden, ganz zu schweigen von der rehgleich plötzlich und scheu auftretenden Leserin, von Leerstellen, die wir alle zu füllen haben, und von wiederentdeckter Lesegemeinschaft. Aus der allzu straffen Übersicht über die modernen Hermeneuten am Schluß des Buches geht vor allem hervor, daß mit dem Dekonstruktivismus vollends alle Maßstäbe für die Auslegung verlorengegangen sind.
Höchste Zeit, mit Konkordanz und griechischem Lexikon wieder zu versuchen, dem biblischen Autor gegenüber loyal zu sein, ihm zuzuhören, auch wenn er Unglaubliches sagt. Schon bei Luther meldete sich an dieser Stelle der Teufel, jedoch möchte ich wetten, daß ihn statt Tintenfäßchen jetzt Laser- oder Tintenstrahl noch zielgerechter treffen könnten. KLAUS BERGER
Peter Müller: "Verstehst du auch, was du liest?" Lesen und Verstehen im Neuen Testament. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994. 241 S., br., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Bei uns freilich meinen die meisten (55 Prozent), sie kennten die Bibel schon, da sie Sprüche von der Art des oben genannten sowie Aufforderungen zu Tugendhaftigkeit enthalte, und brauchten sie daher nicht mehr zu lesen. Das heilige Buch ist heute Überrest einer Lesekultur, die zu den Fermenten unserer Kultur überhaupt gehört. Das Stadium der Schriftlichkeit stellt dabei nur eine Zwischenstufe dar, vermittelnd zwischen Akten des Lebens, genannt Produktion und Rezeption, sowie zwischen Autor oder Übersetzer und Empfänger. An der Schnittstelle zwischen Schriftlichkeit und neuer Aufnahme oder Umsetzung steht das Lesen.
In der Antike und auch im Umkreis der Bibel, in der fremden Lesekultur also, von der Müller berichtet, ist Lesen immer lautes Vorlesen, oft von Sklaven vor ihren Herrinnen und Herren; daher ist noch heute das römische Brevier von den Klerikern nicht still zu lesen, sondern wenigstens halblaut zu murmeln. Anders als bei uns ist damals nicht die Verschriftlichung, sondern das Vorlesen der eigentliche Akt der Veröffentlichung und Weitergabe. Alles Schriftliche zielte nicht auf den stillen Leser, der sich "mit seinem Buch zurückzieht", sondern auf die Erbauung oder den Aufbau einer Gemeinschaft.
In der Antike war Schriftliches zunächst und zumeist in Rollenform gestaltet, wobei die rechte Hand die Rolle hielt, die linke sie am unteren Ende entfaltete und das Ganze nach der Lektüre neu umgekehrt aufgerollt werden mußte. Die frühen Christen hatten dagegen schon früh die Vorzüge der Kodexform erkannt - für den Kodex aber konnte man nur Pergament verwenden. Im Unterschied zur Papyrusrolle waren die Seiten des aus Tierhäuten hergestellten Pergamentkodex doppelseitig beschreibbar. Auch ließen sich so für den gottesdienstlichen Gebrauch Textstellen leichter finden.
Die Verlesung stellt den heiligen Text, wie Müller zeigt, in einen jeweils neuen Kontext, und schon allein dadurch wird er stillschweigend oder ausdrücklich je neu gedeutet. Diese Deutung ist immer auch Auslegung: der Ursprung der Predigt. Zudem hatte man sich zur Zeit Jesu schon lange daran gewöhnt, daß die Juden auch in Palästina das alte Hebräisch nicht mehr verstanden. Ein Übersetzer trug eine aramäische Version in der herrschenden Volkssprache vor, eine oftmals deutlich erweiterte Neufassung des Textes.
Die von protestantischen Pastoren aufgrund eigener Erfahrung so genannte "Antrittspredigt" Jesu in Nazareth nach dem vierten Kapitel des Lukasevangeliums schildert Jesus bei just einer derartigen Auslegung in der Synagoge seiner Vaterstadt. Da Jesus die vorgelesene Jesajastelle kühn auf sich selbst hin deutet, ist für Lukas fortan der Grundsatz legitimiert, daß die Bibel - und für Lukas ist das noch das Alte Testament - auf Jesus hin ausgelegt werden könne. Bei dieser Art Auslegung leisten sich freilich die Verfasser des Neuen Testaments freche Veränderungen des Ausgangstextes, die spätere Gewaltsamkeiten der Deutung als geradezu harmlos erscheinen lassen. So zitiert der Evangelist Matthäus den Propheten Micha: "Und du, Bethlehem, bist die geringste unter den Führungsstädten Judas." Matthäus verbessert: "Und du, Bethlehem, bist keineswegs die geringste unter den Führungsstädten Judas", denn es durfte ja nicht sein, daß Bethlehem gering genannt worden war. Freilich liegen solche Verbesserungen des Sinnes ganz im Rahmen des damals im Judentum und in der Rhetorik Üblichen, und es gab etablierte Regeln, nach denen der Wortlaut der Schrift den Erfordernissen anzupassen war.
Nicht nur die gegenwärtige Verkündigung ist je und je ein Akt des Verlesens, auch bei der Wiederkunft Christi wird es eine Rolle spielen. Dann freilich wird aus den Büchern vorgelesen, die jetzt im Himmel geschrieben werden und die Taten der Menschen verzeichnen. Nach dem späten Mittelalter führt parallel auch der Teufel Buch, und er registriert, konservativ wie er ist, auf dem altertümlichen Schreibmaterial der Kuhhaut so viele Sünden, daß es auf keine Kuhhaut geht.
An die Stelle apokalyptischer Bilder treten in unseren Tagen etwas farblosere Theorien, die dem Akt des Lesens auf der Spur sind und kriminalistisch genau zwischen implizitem und informiertem Leser, zwischen gedachtem und Modell-Leser unterscheiden, ganz zu schweigen von der rehgleich plötzlich und scheu auftretenden Leserin, von Leerstellen, die wir alle zu füllen haben, und von wiederentdeckter Lesegemeinschaft. Aus der allzu straffen Übersicht über die modernen Hermeneuten am Schluß des Buches geht vor allem hervor, daß mit dem Dekonstruktivismus vollends alle Maßstäbe für die Auslegung verlorengegangen sind.
Höchste Zeit, mit Konkordanz und griechischem Lexikon wieder zu versuchen, dem biblischen Autor gegenüber loyal zu sein, ihm zuzuhören, auch wenn er Unglaubliches sagt. Schon bei Luther meldete sich an dieser Stelle der Teufel, jedoch möchte ich wetten, daß ihn statt Tintenfäßchen jetzt Laser- oder Tintenstrahl noch zielgerechter treffen könnten. KLAUS BERGER
Peter Müller: "Verstehst du auch, was du liest?" Lesen und Verstehen im Neuen Testament. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994. 241 S., br., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


