wenig, daß es für die Familie mit elf Kindern gerade gereicht haben wird. Vermögen jedenfalls hinterläßt er keines. Vermutlich hat er sich mehr auf den Handel mit Bildern und Rahmen verlassen.
Vermeer stammt aus einer protestantischen Familie, aber seine Frau gehört zur katholischen Minderheit, immerhin zwei seiner etwa fünfunddreißig erhaltenen Bilder zeigen eine explizit katholische Thematik. Das ist schon fast alles, was wir wissen, und schon dies bißchen ist manchmal zusammenkombiniert. Vom Wichtigsten aber, von dem, was in Vermeers Innerem vorging, wissen wir überhaupt nichts. Wer waren seine Lehrer? Welche Bücher hat er gelesen? Immerhin erfahren wir aus einem Dokument, daß er den älteren Kollegen Gerard Terborch kannte, und das ist keine Nebensache. Terborch war neben dem Dreigestirn von Rembrandt-Hals-Vermeer der größte Menschenschilderer, den Holland in seinem Goldenen Jahrhundert hervorgebracht hat, der Entdecker der seelischen Einsamkeit, einer metaphysischen Leere um den Menschen. Er könnte Vermeer entscheidend beeindruckt haben. Wenn man die Bilder interpretiert, sind die spärlichen biographischen Daten immerhin etwas. Aber reichen sie aus, um eine Biographie zu schreiben? Man mag es drehen und wenden, wie man will, eine Biographie Vermeers scheint bei unserem heutigen Wissensstand nicht sinnvoll.
Der Engländer Anthony Bailey war anderer Meinung und präsentiert tatsächlich eine dreihundert Seiten starke Biographie. Sie erinnert freilich an eine Mogelpackung, denn vom Leben im damaligen Holland ist oft mehr die Rede als vom Maler Jan Vermeer. Emsig werden kulturhistorische Fakten herbeigeschafft, die sich manchmal mehr und meistens weniger mit dem Maler in Verbindung bringen lassen. So werden wir über die große Delfter Pulverexplosion vom 12. Oktober 1654, einer Katastrophe, an der die Nation Anteil nahm, ausführlicher informiert als über die meisten Bilder unseres Malers, und sogar über die Geschichte des holländischen Brauereiwesens erfahren wir etwas mehr, als wir zum Verständnis von Vermeer darüber wissen müßten.
Sinnvoll sind solche Erörterungen nur, sofern es dem Autor gelingt, sie auf seinen Helden zu beziehen. Das aber gelingt Bailey viel zu selten. Er ist kein begnadeter Biograph, sondern ein furchtsam zur Wissenschaft herüberschielender Autor. Von der Wissenschaft hat Bailey sich ein Verfahren abgeschaut, das die besten Wissenschaftler gar nicht anwenden. Er verläßt sich nämlich, sobald es um die Bilder geht, möglichst nur auf schriftliche Dokumente. Aus lauter Furcht, man könne ihm unseriöses Spekulieren vorwerfen, traut er sich gerade bei wichtigsten Fragen nicht, die Lücken zwischen den Daten auszufüllen. Das aber machen Kunsthistoriker unentwegt. Bailey ist offenbar nicht klar, daß die meisten kunsthistorischen Urteile auf Grund von Indizienbeweisen gesprochen werden. Bei Bailey geht es manchmal zu wie im Witz vom Grafen Bobby, der seine Frau mit einem Mann im Schlafzimmer verschwinden sieht und vor der verschlossenen Tür verzweifelt ausruft: "Ewig diese Ungewißheit!" "Es wäre gut, wenn sich die Experten über die Authentizität des Gemäldes ,Die heilige Praxedis' einig werden könnten", schreibt Bailey beispielsweise und macht sich nicht klar, daß es solche Einigkeit, genau genommen, niemals gibt. Irgendein Zweifler meckert immer am Konsens herum, und ein Konsens darüber, daß "Die heilige Praxedis" echt ist, existiert allemal. Wie jede Zankerei kennt auch der Streit der Wissenschaftler eine Hierarchie der Argumente. Nur der ahnungslose Laie meint, in der Wissenschaft herrsche das schiere Chaos von lauter gleichwertigen Ansichten.
So ist man sich auch längst darüber einig, daß Vermeer, als er seinen "Geographen" malte, Rembrandts "Faust"-Radierung kannte. Der Augenschein ist Beweis genug. Pedant Bailey aber belehrt uns, das könne "nicht mit Bestimmtheit gesagt" werden. Und war Vermeer Katholik? Die Forschung geht davon aus, daß er konvertiert ist. Aber da es kein Dokument darüber gibt, geht Angsthase Bailey auf Nummer Sicher und klammert sich an die Möglichkeit, Vermeer sei vielleicht doch nur ein Sympathisant gewesen, der Rücksicht nimmt auf die katholische Ehefrau. Daß eines der Kinder Ignatius hieß, was ein geradezu provokantes Bekenntnis zum Jesuitenorden war, reicht maßgeblichen Forschern als Beleg, nicht aber Bailey. Die beiden katholischen Bilder sind ihm unheimlich, und in der Tat lassen sie sich dem gewohnten Bild von Vermeer schwer vereinbaren. Aber statt sich im siebzehnten Jahrhundert umzuschauen, ob es nicht mehr solche malenden Chamäleons gegeben haben könnte, will Bailey sich lieber vorstellen, der Maler habe es nicht gar so ernst gemeint.
Manchmal schreibt Bailey erschreckend holprig, zumindest klingt es so in der Übersetzung. So schreibt er, daß Camera obscura "wörtlich dunkles Zimmer bedeutet. Dies könnte sowohl ein Zimmer sein, aus dem das Licht ausgesperrt wurde und in dem der Zuschauer saß, oder aber eine Handlung, in die der Betrachter hineinschaute." Man darf bezweifeln, daß ein Leser ohne Vorkenntnisse sich daraufhin den an sich ganz einfachen Mechanismus einer Zeichenkamera richtig vorstellen wird. Ein hübscher Einfall ist es, in einem Modell die Frau Vermeers zu vermuten, denn "da ist etwas Besonderes in dem zwar abstrahierten, aber freundlichen Gesichtsausdruck, mit dem die Frau in dem Gemälde ,Briefschreiberin in Gelb' aufschaut und mit den Augen den konzentrierten Blick des Malers sucht, der uns zu sagen scheint: Das ist sie." Nachdenklich macht auch seine behutsam begründete Vermutung, Vermeer könnte, verarmt und ohne Aufträge, zum Alkoholiker geworden und deshalb so plötzlich gestorben sein. Dieses Erwecken des Leserinteresses ist immer wieder das Beste, was Kunstliteratur jenseits aller Wissenschaft vermag. Leider sind solche Momente bei Bailey viel zu selten.
Die demonstrative Zurückhaltung, die Bailey angesichts kunsthistorischer Thesen an den Tag legt, fehlt ihm völlig, wenn er glaubt, drauflosschwadronieren zu dürfen. Dann war er damals in Delft persönlich dabei ("Kutschen und Handkarren ratterten") und stellt sich phantasievoll vor, wie der kleine Jan am Vorabend des Nikolaustages "seinen Schuh hinausgestellt" haben könnte und ob der Maler seinem Modell vielleicht "gesagt hat: ,Zieh bitte dies oder das Kleid an', ,Leg heute diese Perlenohrringe an' oder ,Binde dir die blauen Bänder ins Haar, damit siehst du besonders hübsch aus'". Und was wir schon immer wissen wollten, nämlich "Welche Haustiere hat man im Hause Vermeer wohl gehalten?", ist Bailey eine Erörterung von mehr als zwanzig Zeilen wert, ohne daß er eine Antwort findet. Ewig diese Ungewißheit.
Anthony Bailey: "Vermeer". Aus dem Englischen von Bettina Blumenberg. Siedler Verlag, Berlin 2002. 304 S., 49 S/W-Abb., 14 Farbtaf., geb., 24,90
.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main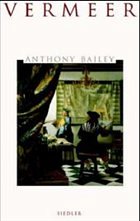





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.03.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.03.2002