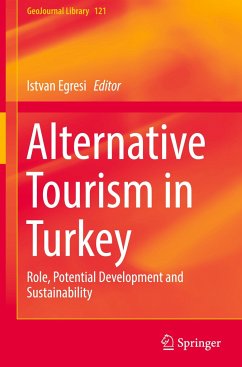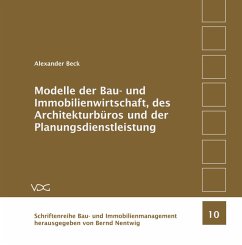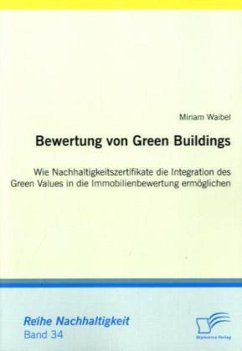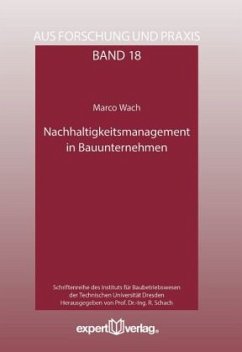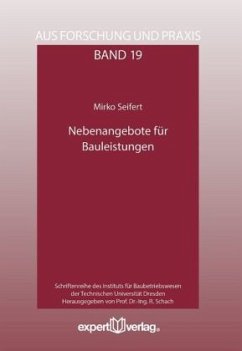von 35 auf 41 Millionen.
"Wir bauten genug neue Wohnungen, um darin sämtliche Niederländer unterzubringen, obwohl die Zahl der Einwohner hierzulande stagniert", schreibt der Verfasser. Jedes Jahr kommen noch eine viertel Million Wohnungen hinzu, etwa so viel, wie es in Braunschweig und Kassel zusammen gibt. Weshalb? Immer mehr Menschen leben allein, und jeder möchte ein eigenes Bad, eine eigene Küche und einen eigenen Abstellraum.
Banken und Bausparkassen verdienen gut an Baukrediten. Auch der Staat zahlt kräftig fürs Bauen: Wohnungsbauprämie, Wohn-Riester, Pendlerpauschale. In Zukunft wird die Einwohnerzahl sogar sinken. Deshalb sei das Eigenheim als Altersvorsorge keine gute Idee, meint Fuhrhop: "Wenn es ums Geld geht, sollte man eher in eine Wohnung in einer boomenden Großstadt investieren und nicht in seinen persönlichen Lebenstraum." Immobilien machten immobil, was berufliche Veränderungen behindere: "Wo die Menschen besonders mobil sind, da entstehen mehr Arbeitsplätze. Immobile Menschen dagegen ziehen nicht dorthin, wo ihre Arbeitskraft gebraucht wird. Kurzum: je mehr Wohneigentum, desto schlechter für die Wirtschaft."
Doch für viele Deutsche sei Bauen mythologisch aufgeladen. Dabei werde Bauen mit neu Bauen gleichgesetzt und Eigentum mit Eigenheim. Doch der Hausbau mit Glücksgarantie sei eine Illusion, was schon mit der Lage beginne: Ein "Haus im Grünen" soll es im Idealfall sein, doch mit jedem neuen Haus bleibt weniger Grün übrig. Der Eigenheimer pendelt in die Stadt und schafft sich zusätzlich Stress. "Das Leben im Vorort", schrieb schon 1965 Alexander Mitscherlich, "wird zu einer Belastung, weil man es nur nach erschöpfenden Fahrten in verstopften Straßen erreichen kann", und er forderte: "Wir müssen lernen, darauf zu verzichten, durch Bauwerke unseren Status zu repräsentieren."
Eine große Abneigung verspürt Fuhrhop auch gegen das "angebliche Ökohaus". Ob Niedrigenergiehaus, Effizienzhaus oder Passivhaus - was so klimafreundlich klingt, schade aus drei Gründen: Erstens baut man diese Häuser meist am Stadtrand, wo die Wege länger werden und weniger Busse fahren. Zweitens benötigen diese Häuser Platz, wo es bisher Grün war oder ein Gebäude stand. Drittens verbrauchen grüne Gebäude eine Menge Energie beim Bauen.
"Und wer ins Ökohaus zieht, konsumiert vielleicht besonders viel", meint Fuhrhop. So macht der Umweltökonom Niko Paech auf den "psychologischen Rebound-Effekt" aufmerksam: Als moralischen Ausgleich für das scheinbar ökologische Verhalten gönnt man sich an anderer Stelle "etwas Besonderes", etwa als Vielflieger. Diese Form des "Bumerangeffekts", wie ihn Ernst Ulrich von Weizsäcker nennt, unterwandere jeden ökologischen Fortschritt.
Mancher Effizienzgewinn in der Wirtschaft spare unterm Strich nichts ein, sondern führe sogar zu mehr Energieverbrauch. Letztlich schlagend ist aber Fuhrhops Beschäftigungsargument: Würde in Zukunft mehr umgebaut, schaffe das zusätzliche Arbeitsplätze. Ein Umbau brauche weniger Material, aber mehr Arbeitszeit als ein Neubau. Allerdings: Haben wir die Arbeitskräfte, die das leisten können, überhaupt noch in Deutschland?
Fuhrhop formuliert eine Utopie. Immerhin kann er sich auf gesellschaftliche Entwicklungen stützen: In vielen Städten wollen die Einwohner leer stehende Wohnungen wieder genutzt sehen und sammeln Informationen über verlassene Häuser auf der Internetseite "Leerstandsmelder". In Hamburg wurden vor sechs Jahren die abrissgefährdeten Häuser im Gängeviertel besetzt, in den ehemals mit Brettern vernagelten Erdgeschossen finden sich nun Werkstätten junger Schreiner oder Drucker. Dass man Hausbesetzer einmal als Denkmalschützer bezeichnen würde, hätte in der Hansestadt niemand gedacht.
In Berlin verhinderten Bürger aller Schichten und politischer Richtungen die Bebauung des "Tempelhofer Feldes". An vielen Orten nehmen Menschen brachliegende Allgemeinflächen in Besitz und gründen dort Gärten, wie jüngst das österreichische Magazin für Landschaftsplanung und Freiflächen, "zoll+", dokumentiert hat. Diese Initiativen leisten einen Beitrag zur Sicherung von sozialer Marktwirtschaft und natürlichen Lebensgrundlagen.
Fuhrhop nimmt all dies auf und geht noch weiter. Es soll mehr umgebaut, umgenutzt und nachgedacht werden. "Bauen im Bestand" nennen das die Denkmalpfleger, die sich rasch an Fuhrhops Seite wiederfinden werden. Ebenso die Rechnungshöfe, denen der neue Berliner Flughafen oder die Elbphilharmonie den Schlaf rauben; vom Bremer Spacepark und dem Freizeitpark Nürburgring ganz zu schweigen. Schließlich freuen sich die Umweltschützer, denn Neubauten sind immer ökologisch belastender als Sanierungen, und meist auch teurer, wenn "graue Energie" einberechnet wird, die auch die Produktion der Baustoffe umfasst. Heutige Wärmedämmung an Fassaden von Altbauten schadet zudem oft, lässt den Stromverbrauch in die Höhe schießen und wird der Sondermüll von morgen. Fuhrhop hat eine kenntnisreiche, erschreckende, aber dank vieler positiver Beispiele auch ermutigende Streitschrift geschrieben.
JOCHEN ZENTHÖFER
Daniel Fuhrhop: Verbietet das Bauen! oekom Verlag, München 2015, 192 Seiten, 17,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
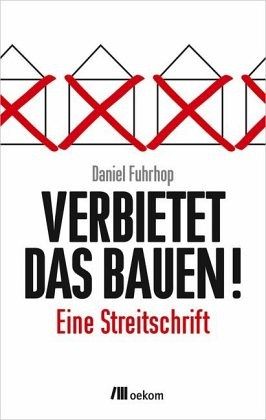





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.05.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.05.2016