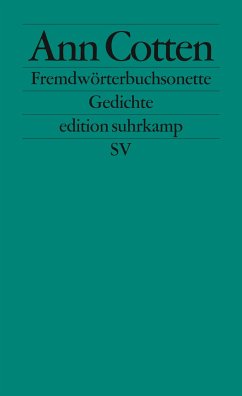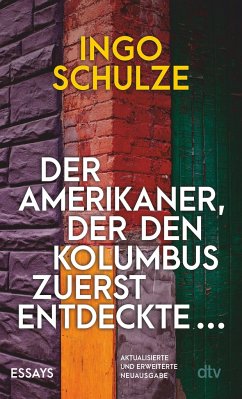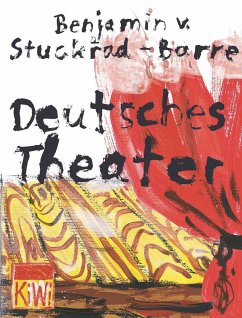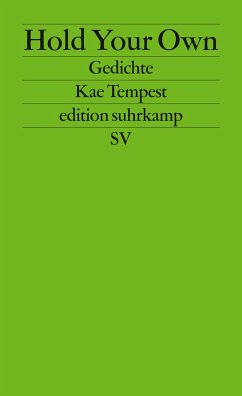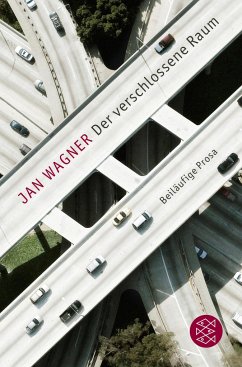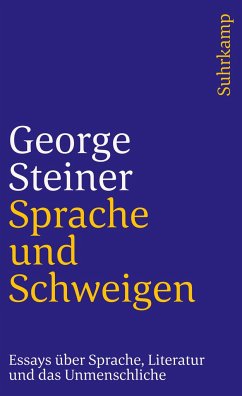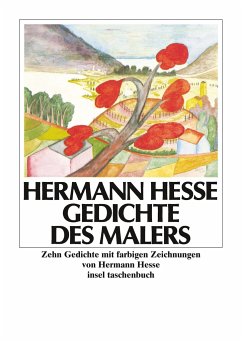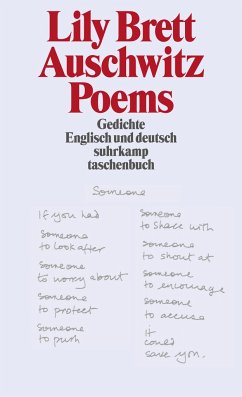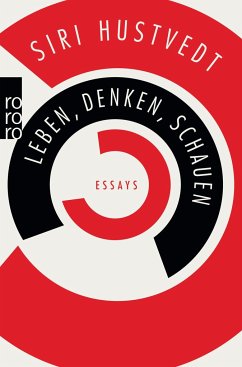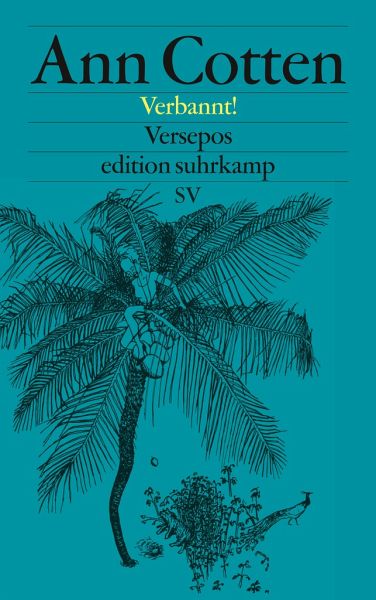
Verbannt!
Versepos
Illustrator: Cotten, Ann

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Tosende Palmen, ein Rascheln im Sellerie, ein Tiger verschwindet, in der Ferne detoniert eine Atombombe, und das Bewusstsein beginnt, rückwärts zu laufen. Es gehört einer Fernsehmoderatorin, die aufgrund wiederholten Fehlverhaltens auf eine einsame Insel verbannt wurde, ausgestattet nach eigener Wahl mit Messer, Schleifstein und Meyers Konversations-Lexikon.Doch sie ist nicht allein. Hier sind schon fünfundzwanzig Matrosen, die in den Jahren seit ihrem Schiffbruch eine beachtliche kleine Parallelgesellschaft aufgebaut haben, sie heißt Hegelland. Ursprünglich Quäker, hängen sie jetzt de...
Tosende Palmen, ein Rascheln im Sellerie, ein Tiger verschwindet, in der Ferne detoniert eine Atombombe, und das Bewusstsein beginnt, rückwärts zu laufen. Es gehört einer Fernsehmoderatorin, die aufgrund wiederholten Fehlverhaltens auf eine einsame Insel verbannt wurde, ausgestattet nach eigener Wahl mit Messer, Schleifstein und Meyers Konversations-Lexikon.Doch sie ist nicht allein. Hier sind schon fünfundzwanzig Matrosen, die in den Jahren seit ihrem Schiffbruch eine beachtliche kleine Parallelgesellschaft aufgebaut haben, sie heißt Hegelland. Ursprünglich Quäker, hängen sie jetzt der selbsterfundenen Schraubenreligion an und unterhalten in arbeitsamer Kulturleistung drei Pressen von kontinuierlich steigender Druckqualität. Was wird nun angesichts der ersten Frau passieren, und was, wenn mehr kommen?In 399 Neo-Spenser-Strophen schildert Ann Cotten die Turbulenzen, die nach einer weiblichen Flüchtlingswelle aus dem Internet in Hegelland entstehen. Die verschuldeten Prothesenträgerinnen werden unwillentlich zum Katalysator einer schon lange schwelenden Konterrevolution. Mithilfe von Reimen, Anspielungen, synästhetischen Zwängen und großer Anschaulichkeit wird dieser luzide Alptraum auch in Ihr Bewusstsein gehämmert.