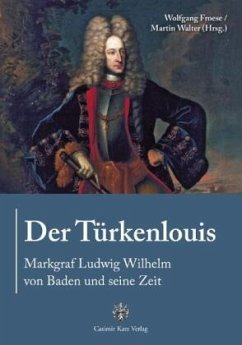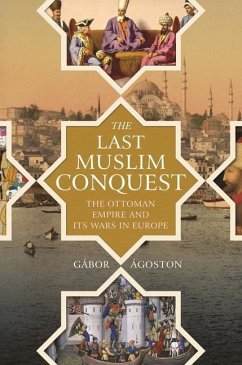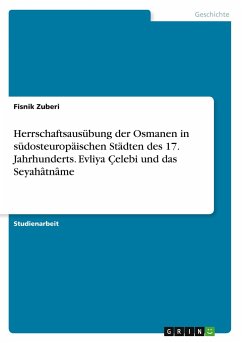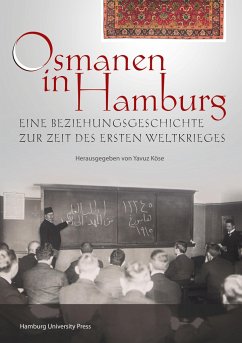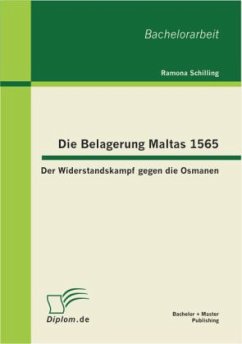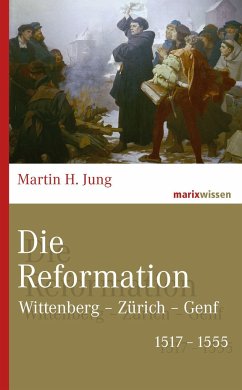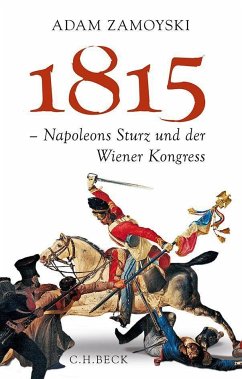sich der Vorhang der Geschichte, die Ekkehard Eickhoffs Buch durchmisst. Hinter ihm, im Licht der Schiffslampen, Wachskerzen, Kristalllüster und Holzfackeln, tritt das siebzehnte Jahrhundert aus der Dunkelheit, in die es die moderne Historiographie gesenkt hat. Das Interesse des zwanzigsten Jahrhunderts an dieser Zeit der Haupt- und Staatsaktionen, der Religionskämpfe, der Kronräte, Großwesire und Nuntii war gering, es beschränkte sich im Wesentlichen auf den Dreißigjährigen Krieg und die Geschehnisse an der europäischen Peripherie, wo Engländer und Niederländer ihre Kolonialreiche auf Kosten von Spaniern und Portugiesen ausdehnten. Das Europa der zweiten Jahrhunderthälfte, in der mit der Befreiung Wiens, der Rückeroberung Ungarns, dem Aufstieg Brandenburgs und dem Vordringen Frankreichs zur Rheingrenze die politischen Weichen bis ins Zeitalter Bismarcks gestellt wurden, fand sich nur in Einzeluntersuchungen gewürdigt, deren Autoren, den Nationalgrenzen späterer Zeiten folgend, sich an preußische, österreichische, osmanische oder französische Sichtweisen hielten. Mit Ausnahme, versteht sich, von Ekkehard Eickhoff.
Als Eickhoff in den sechziger Jahren mit der Arbeit an seinem Buch begann, lag das Erscheinen von Fernand Braudels epochaler Studie über die Mittelmeerwelt zur Zeit Philipps II. erst fünfzehn Jahre zurück. Annalisten und Strukturhistoriker übernahmen die Macht in der Geschichtswissenschaft. Trotzdem wollte Eickhoff Ereignisgeschichte schreiben. Als Mitarbeiter in der Ost-Abteilung des auswärtigen Dienstes und an den bundesdeutschen Botschaften in Kairo und Ankara hatte er den Mittelmeerraum und die osteuropäische Staatenwelt studiert. In den Archiven von Istanbul und Venedig las er die Korrespondenz zwischen der Hohen Pforte, der Serenissima und den Höfen in Wien und Paris. Seine Geschichtserzählung, deren erste Auflage 1970 erschien, widmete er den Staatsdienern des Barock, "die mitten im Wirbel umwälzender Ereignisse mithandelnd und -leidend dieses Geschehen doch mit kühler Klarsicht beleuchten". Es war, mitten im Kalten Krieg, die Verbeugung eines Diplomaten vor seinesgleichen, eine unzeitgemäße Geste in einem unzeitgemäßen Buch.
Die Neuausgabe von "Venedig, Wien und die Osmanen", die Eickhoff jetzt erstellt hat, ist mehr als eine bloße Überarbeitung; sie ist, wenigstens in Teilen, ein neues Buch. Wo die frühere Fassung mit dem Vorstoß Russlands zum Schwarzen Meer und dem Tod des Dogen Francesco Morosini in Nauplia endete, weitet die neue den Blick über die Friedensschlüsse von Karlowitz und Passarowitz hinaus ins Jahr 1919, in dem die siegreichen Entente-Mächte die alte Sultanshauptstadt Istanbul an die junge türkische Republik übergeben. Die Beschreibung von Schlachten und Belagerungen tritt zurück, die Schilderung der Nöte der Zivilbevölkerung nimmt breiteren Raum ein. Dem Kapitel über die Rückeroberung Ungarns durch die Habsburger stellt Eickhoff nun eine Erörterung zur Kampfkraft und Bewaffnung stehender Heere voran, die erkennbar durch die Arbeiten Geoffrey Parkers zur "Military Revolution" der frühen Neuzeit geprägt ist. Zuletzt hat der Autor auch die Spuren des Kalten Krieges aus seinem Text getilgt. Der Abschnitt über die Zaporoger Kosaken und ihren Unabhängigkeitskampf endete 1970 mit einem Hinweis auf die Vernichtungspolitik Stalins. Heute stellt Eickhoff fest, die nachsowjetische Geschichtsschreibung habe die Heldentaten der Kosaken übertrieben. Zur Idealisierung seien sie so wenig geeignet wie ihre Gegner, die Tataren.
Die Kälte, die in solchen Urteilen aufscheint, ist kein Zeichen von Distanz, im Gegenteil. Eickhoff ist so leidenschaftlich an den Geschehnissen interessiert, die er beschreibt, dass er ihren Protagonisten nicht das Unrecht einseitiger Parteinahme antun möchte. Die Verdienste der osmanischen Großwesire Mehmed und Ahmed Köprülü schildert er ebenso zugeneigt wie den Schlachtenruhm des Dogen Morosini, der für Venedig die Peloponnes - das damalige "Königreich Morea" - eroberte und auch für die Explosion des Parthenons verantwortlich ist. Dennoch kann er auch ihnen den Vanitas-Schlussakkord der Geschichte nicht ersparen: Das Reformwerk der Köprülüs wird von ihren Nachfolgern zerstört, und Morosinis Feldzug ist von vornherein eine Donquichotterie, auch wenn die Festungsmauern mit dem Markuslöwen darauf noch heute über griechischen Hafenstädten thronen.
Das gute halbe Jahrhundert, das Eickhoffs Darstellung umfasst, ist durch eine Folge einander überlagernder, an allen Ecken Europas aufflammender Kriege geprägt: den venezianisch-türkischen "Krieg um Kandia", der 1669 mit der Kapitulation der kretischen Hauptstadt endete; den Krieg zwischen Habsburg und den Osmanen von 1663/64, der trotz des Christensieges bei Sankt Gotthard an der Raab zum Verlustfrieden von Vasvár führte; die Expansionspolitik Ludwigs XIV. am Rhein zwischen 1667 und 1697, gegen die sich zuletzt fast alle anderen westeuropäischen Mächte zusammenschlossen; die Waffengänge zwischen Polen, Kosaken, Tataren und osmanischen Heeren in den sechziger und siebziger Jahren; und schließlich den "Großen Türkenkrieg", der 1683 mit der Belagerung Wiens begann und sechzehn Jahre später mit der Rückeroberung Ungarns und Siebenbürgens durch den Westen endete.
Nebenbei schlagen sich die Franzosen mit den Barbareskenstaaten Nordafrikas, die Habsburger mit den ungarischen Kuruzen, die Venezianer mit kroatischen Piraten und die Türken mit den Maltesern herum. Dass zwei Schiffe zwischen Kairo und Gibraltar einander begegnen, ohne dass ein Schuss fällt, ist beinahe die Ausnahme. Nur im Winter, wenn Stürme über das Mittelmeer fegen und der gesamte Balkan im Frost erstarrt, kommt das ewige Morden zur Ruhe. Piraten aller Couleur flüchten zu den warmen Kaminen und liebreizenden Hafenmädeln von Paros; der christliche Adel feiert in den Schlössern von Krakau und Wien, der muslimische in den Palästen am Goldenen Horn; und die Soldaten beider Seiten siechen in ihren Quartieren an Donau, Theiß und Dnjestr elend dahin.
Die Gemengelage der großen und kleinen Mächte bringt die absurdesten Kombinationen hervor. Franzosen und Brandenburger, die im Schicksalsjahr 1669 gemeinsam Kandia gegen die Türken verteidigen, stehen einander sechs Jahre später am Rhein als Feinde gegenüber. Die Siebenbürger schlagen gegen die Polen los und werden dafür von der Hohen Pforte gezüchtigt, bevor diese selbst Polen den Krieg erklärt. Der französische Favorit Johann Sobieski wird zum polnischen König gewählt und befreit das habsburgische Wien, worauf Ludwig XIV. sich mit dem Sultan verbündet, gegen den Sobieski seine Schwadronen führt. Zu all den Massakern und Intrigen bildet die Orientreise des Marquis de Nointel ein magisches Interludium. Statt für seinen König am Bosporus herumzuspionieren, wallfahrtet Nointel zwei volle Jahre lang zu den Stätten der Antike. Den Parthenon sieht er noch in ganzer Pracht, aus Palästina bringt er neben alten Münzen und Vasen ein Exemplar der "Märchen aus 1001 Nacht" mit. In Paris aber fällt er in Ungnade, wird abberufen, muss seine Schätze verkaufen und stirbt in tiefer Armut.
Eickhoff beleuchtet die Widersprüche dieser Barockwelt mit einer an klassischen Vorbildern, an Ranke, Mommsen und Droysen geschulten Diktion. Der einzige Fehler seines Buchs besteht darin, dass es nach vierhundertfünfzig Seiten aufhört. Man könnte ewig weiterlesen, um noch mehr über die Zaubergärten der Ägäis, die Prinzenkäfige im Serail, die Festungen an den Dardanellen und die Seeschlacht von Naxos zu erfahren. In seinem jüngsten, vor zwei Jahren erschienenen Buch hat Ekkehard Eickhoff das "späte Feuerwerk" der Republik Venedig beschrieben. Hier nun zeigt er das reiche Farbenspiel einer erzählenden Historiographie, die mit den Theoriediskussionen des vergangenen Jahrhunderts ausgestorben schien. Aber vielleicht hat sie ihre beste Zeit ja erst noch vor sich.
Ekkehard Eickhoff: "Venedig, Wien und die Osmanen". Umbruch in Südosteuropa 1645-1700. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2008. 464 S., 50 S/W-Abb., Vorsatzkarten, geb., 29,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
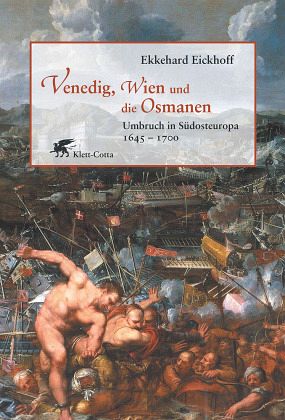





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2008