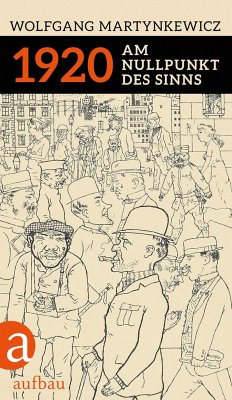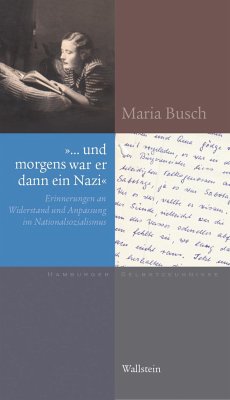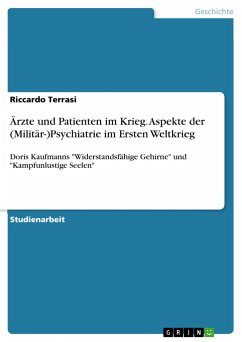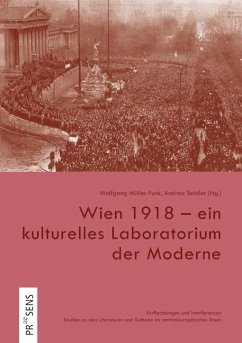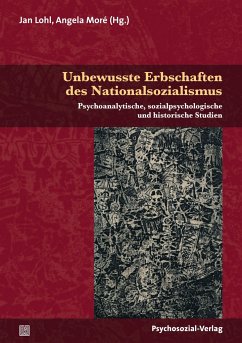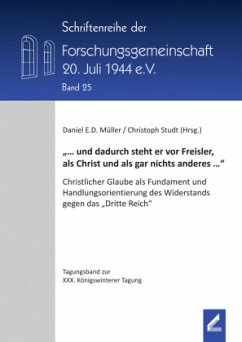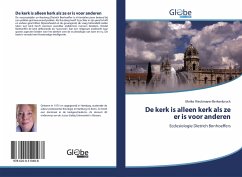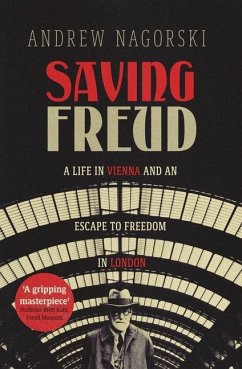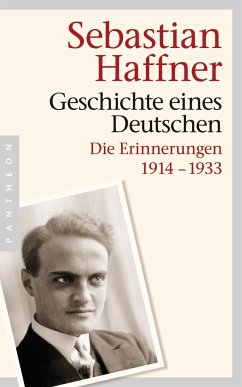die "Rattenfolter", bei der ein Sträfling mit entblößtem Gesäß an einen Topf gekettet wird, in dem sich eine Ratte befindet. Der Patient, der von der Vorstellung besessen war, die Strafe könnte sich an seinem bereits verstorbenen Vater und an einer von ihm leidenschaftlich verehrten Dame vollziehen, wurde schon bald nach Veröffentlichung der Krankengeschichte in psychoanalytischen Zirkeln als der "Rattenmann" bekannt. Die 1909 veröffentlichten "Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose" zählen zu den ausführlichsten Falldarstellungen Freuds und haben eine Fülle von Kommentaren hervorgebracht, nicht zuletzt, weil die handschriftlichen Notizen der Behandlung ausnahmsweise erhalten und seit den siebziger Jahren ungekürzt veröffentlicht sind.
Im Gegensatz zu anderen berühmten Patientinnen und Patienten Freuds war über den "Rattenmann" bisher nicht viel bekannt. Kein Bildnis ist von ihm überliefert. Da er bereits in den ersten Wochen des Ersten Weltkrieges gefallen war, hatte seine Analyse kein wechselvolles Nachspiel - wie etwa bei dem bis ins hohe Alter auskunftsfreudigen Sergej Pankejeff, besser bekannt als der "Wolfsmann". Dementsprechend galt der Fall des Rattenmannes nicht nur als ein theoretisches Glanzstück Freuds, sondern auch als der einzige längere publizierte Bericht einer Therapie, die nachweislich zu einer vollständigen Heilung des Patienten geführt hatte.
1986 identifizierte der kanadische Psychoanalytiker Patrick Mahony Freuds Patienten als Ernst Lanzer und verwertete eine Reihe von biographischen Informationen für seine Neuinterpretation der Freudschen Fallgeschichte. Nun hat der Wiener Psychoanalytiker Georg Augusta die erste längere biographische Darstellung über den jungen Juristen vorgelegt, die eine bisher unbeachtete Spur verfolgt. Bereits in den vierziger Jahren hatte Ernst Lanzers Nichte, die Schriftstellerin Elisabeth Freundlich, an einem Buch über ihre Familie zu arbeiten begonnen, das den Titel "Der Seelenvogel" trug, doch erst 1986 veröffentlicht wurde.
Der Roman verknüpft historische Ereignisse mit den Erinnerungen der Autorin an die Erzählungen ihrer Verwandten und dient Augusta zur Rekonstruktion der Familiengeschichte von Freuds Patienten. Wesentliche Aufschlüsse bietet Freundlichs Buch vor allem über die sozialen und ökonomischen Verhältnisse des Haushalts: Im Zentrum steht der Vater Heinrich Lanzer, der aus kleinen Anfängen zum Prokuristen einer Fleischfabrik und bald auch in die Welt des Wiener Bildungsbürgertums aufsteigt. Neben der Anstellung von Dienstboten und Gouvernanten für die anwachsende Kinderschar und dem obligaten Klavier im Salon zählt die gymnasiale Ausbildung seiner beiden Söhne zum zentralen Ausweis des sozialen Aufstiegs. Das erste Geschenk für den angehenden Gymnasiasten Ernst, Visitenkarten mit dem Titel "Stud. Gym.", verweist auf den väterlichen Auftrag, dem der Sohn jedoch nicht gerecht werden konnte.
Die Verwendung dieser literarischen Quelle und anderer Stücke aus dem Nachlass von Elisabeth Freundlich erlauben es Augusta nicht nur, eine Reihe von Akteuren zu identifizieren, sondern auch ein weitaus differenzierteres Bild des berühmten Patienten Freuds zu entwerfen. Erfreulicherweise verzichtet der Autor dabei weitgehend auf psychoanalytische Weiterdeutungen des Falles und macht eher den sozialen Kontext sichtbar, in dem sich sowohl Freud wie auch sein Patient bewegten. Beide stammten aus jüdischen Familien, die in das Bildungsbürgertum aufstrebten - dies mag einer der wesentlichen Gründe dafür sein, warum Freud eine so starke Sympathie für Ernst Lanzer bekundete, den er in seinen Originalnotizen einen "klaren scharfsinnigen Kopf" nannte.
Die lebensweltliche Verbundenheit äußerte sich auch im Gebrauch jiddischer Worte (Chonte, Parch, Schickse), die sich in der publizierten Fassung Freuds nicht mehr finden. Durch die Rekonstruktion der ökonomischen Lage des "Rattenmannes" relativiert Augusta entscheidend die klassische Interpretation für das berühmte Problem der Schuld des Patienten, das sich im zwanghaft verworrenen Auftrag der Rückzahlung eines geringen Geldbetrags äußert. Nicht der Tod des Vaters sowie die Schuldvorwürfe des Sohnes, am Sterbebett des Vaters gefehlt zu haben, hätten primär die Neurose ausgelöst, sondern das Erreichen der Volljährigkeit und damit der Konflikt, der mit der möglichen Verfügung über das beträchtliche väterliche Erbe ausbrach: "Es war das Ende der Vormundschaft, der Beginn der Volljährigkeit, die Hemmung, sich von den Ansprüchen der Mutter loszusagen, welche Ernst veranlassten, ,sich in die Krankheit zu flüchten'."
Zu Beginn der Behandlung bei Freud verwaltete die Mutter sein Vermögen und verfolgte den Plan, ihn mit der Tochter eines reichen Verwandten zu verheiraten. Nach Abschluss der einjährigen Therapie gewann Ernst Lanzer soviel Unabhängigkeit, um eine Laufbahn als Rechtsanwalt beginnen zu können. Er richtete sich in einer Praxis ein und heiratete schließlich 1910 seine Jugendliebe Gisela Adler, jene verehrte "Dame", welche er mehr als zehn Jahre mit einer Gefühlsmischung aus Liebe und Hass bedacht hatte, einer Einstellung, die Freud auf den für die Psychoanalyse zentralen Begriff der "Ambivalenz" brachte.
Die genauen Umstände des Todes von Ernst Lanzer, der im November 1914 an der Grenze von Ungarn und Galizien als Oberleutnant eines Landsturminfanterieregiments als vermisst gemeldet wurde, sind nicht mehr zu erhellen. 1923 verfasste Freud einen Nachsatz zu seiner Krankengeschichte, in dem er knapp festhielt, dass sein Patient "wie so viele andere wertvolle und hoffnungsvolle junge Männer im großen Krieg umgekommen" war.
ANDREAS MAYER
Georg Augusta:
"Unter uns hieß er der Rattenmann". Die Lebensgeschichte des Sigmund-Freud-Patienten Ernst Lanzer.
Mandelbaum Verlag, Wien 2020. 160 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
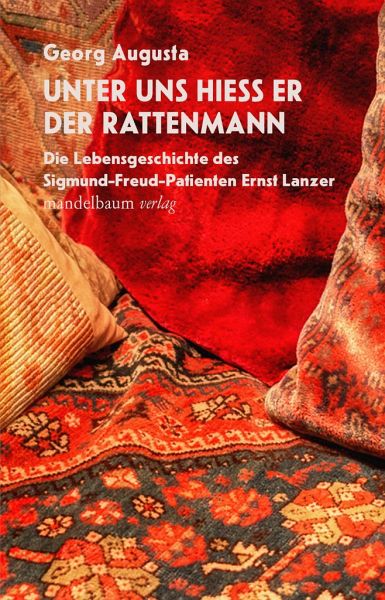




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.07.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.07.2020