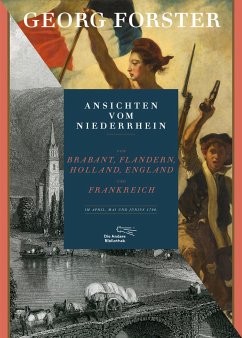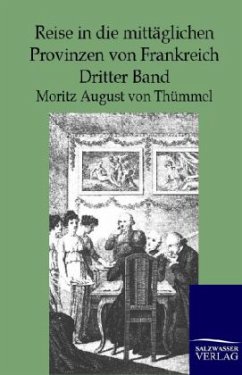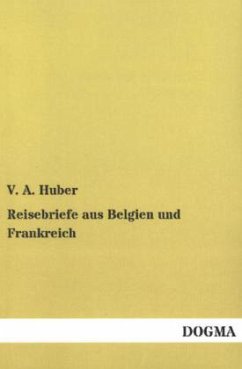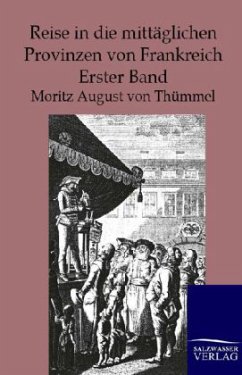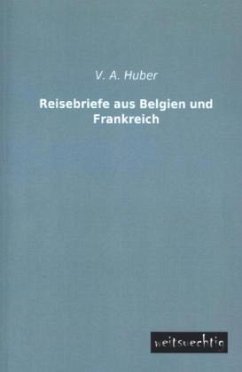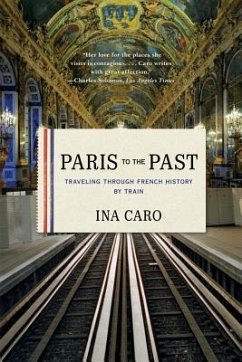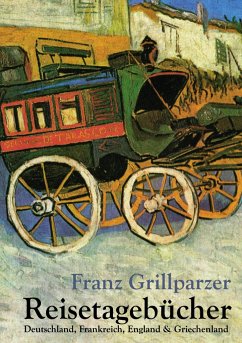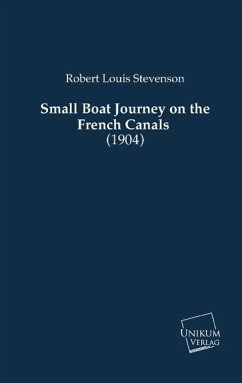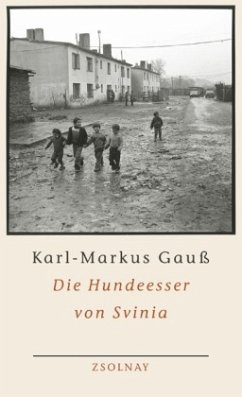vielleicht Verbündete von Strindbergs eigenem Eigensinn. Das macht aus diesem Buch eine Sache, die wie geschaffen ist für Eichborns "andere" Bibliothek. Sie ist mit nichts sonst vergleichbar und ihrem Inhalt nach auf seltsame Weise wahr-fingiert. Wer je für Frankreich, für das Bauerntum oder für Strindberg empfänglich war, gibt diesen Band nicht so schnell wieder aus der Hand.
Der ruhelose Literat konnte in jenen Jahren der Heimvölkerkunde, der aufkommenden Sozialspannungen, des Naturalismus und der illustrierten Reiseberichte offenbar gar nicht anders, als dem Ruf der Fakten zu folgen. Weg vom Roman, hin zur Reportage. Frankreichs Bauern, unter denen er in einem Dorf südwestlich von Paris 1883 selbst eine Zeitlang gelebt hatte, wurden für ihn zugleich Gegenstand und Projektionsfläche seines Vorhabens. "Sehen Sie nun, dass hinter der Arbeiterfrage die Bauernfrage liegt?" - sagt in einer hinzuerfundenen Einleitungsszene des Buchs auf dem Montmartre ein Pariser zum Besucher aus Nordeuropa, der auf der Stelle beschließt, hinauszugehen aufs Land und sich die Situation dort selbst anzuschauen. Er ist der Überzeugung, dass entgegen den landläufigen Theorien des "Maschinensozialismus" der kleine Parzellenbauer kein Auslaufmodell der Geschichte sei, im Gegenteil. Auf Grund des demokratischen Drucks von unten und der teuer gewordenen Arbeitskraft auf dem Land sei er die Verkörperung einer aussichtsreichen Wirtschaftsform - der Pächter wolle nicht einmal mehr Besitzer, sondern allenfalls Großpächter werden, wundert sich der Autor.
Beim Spaziergang auf dem Feld draußen vor dem Dorf, in dem er sich niedergelassen habe, schreibt Strindberg im ersten Teil dieser Reportage, habe er gerade einen Tagelöhner gesehen, der mit seiner Hacke eine Kleeweide bearbeitete. Sein Anzug bestand aus schwarzer Samthose, einer dunklen Wollweste und einem weißen Hemd, dessen Manschetten strahlend weiß leuchteten. Eine Uhrkette baumelte an der Westentasche - "so glich er einem Buchhalter eher als einem Bauern". Dieser Mann wohne im Hotel, mit Vollpension, fand unser Reporter heraus, also Suppe, Gemüse, Fleisch oder Speck sowie einem halben Liter Wein, und an den Sonntagen spiele er Billard. Nicht alle Bauern, denen Strindberg begegnete, standen in so vorteilhaften Verhältnissen. Über alle sozialen und regionalen Unterschiede des Bauernlebens hinweg zeichnet sich in diesem Buch aber eine Grundfigur Strindbergscher Wunschprojektion ab. Die Bauern sind republikanisch eingestellt, atheistisch, entschieden antiklerikal. Sie sind eine Art Rebellen der Scholle gegen den die Welt bedrohenden Zangenbiss von Kapitalismus und Sozialismus. Oder, wie Thomas Steinfeld in seinem Nachwortessay zu diesem Band es nennt: "August Strindbergs Parzellenbauer lebt in einer im Grund gutmütig verfassten Anarchie."
Vieles von den Detailangaben über Ernteerträge, Lebensunterhaltskosten, Kinderzahl mag angelesen sein in diesem Buch. Da Strindberg sich aber nie ganz vom Schriftsteller zum Journalisten mausern kann, wirkt die Beschreibung echter als echt. Die "belle France" am Rand des Pariser Beckens mit ihrer sanft flimmernden Lufttrübung ohne starke Schatten und harte Linien über den Flussläufen, das neue französische Schulsystem mit dem obligatorischen Volksunterricht oder die aufkommenden Leihbibliotheken landesweit werden mit einer für Strindberg ungewohnten Freundlichkeit beschrieben. Der noch herumliegende "Bodensatz" christlicher Moral und Sinnenfeindschaft wird nur am Rande erwähnt, denn in den geselligen französischen Dorfschenken sei er schon fast vergessen. Selbst Strindbergs notorische Allergie gegen Frauenemanzipation begnügt sich mit einem müden Bedauern, wie leicht die "herrschsüchtigen, unsentimentalen, praktischen" Französinnen ihre ritterlich veranlagten Männer untergekriegt hätten.
Geht der erste Teil dieser Reportage auf die Beobachtungen des Autors während seines Aufenthalts in der skandinavischen Künstlerkolonie des Dorfs Grez-sur-Loing zurück, so beruht der zweite Teil auf einer tatsächlich unternommenen Rundreise. Im Spätsommer 1886 fuhr Strindberg mit der Eisenbahn dritter Klasse in Windeseile durch ganz Frankreich. Für die dreitausend Kilometer von Basel aus über Lille, die Normandie und die Bretagne, dann Bordeaux, Toulouse und Montpellier, schließlich das Rhonetal hinauf über Dijon wieder zurück, hatte der Autor aus Geldknappheit kaum mehr als drei Wochen veranschlagt. Die Etappenberichte aus all diesen Regionen gehören aber zum Reizvollsten, was wir an Alltagsbeschreibung des Landlebens aus jener Zeit haben. "Wie war die Ernte dieses Jahr?" - diese wiederkehrende Frage dürfte der Autor aus Zeitmangel meist wohl eher nachträglich in seine Dialoge hineinmontiert haben. Die Texte sind dennoch lebendig und aufschlussreich. "Ist es das amerikanische Getreide, das die Preise drückt?" - fragt der Reisende auf einer Landstraße bei Vesoul in der Franche-Comté zwei Bauern. Oh, es sei nicht nur Amerika, "es ist das ganze Ausland, das Frankreich auf allen Seiten ruiniert". Gerade habe der französische Marineminister mit Holland einen Vertrag über eine Großlieferung von Käse abgeschlossen, klagt der Landwirt aus der für ihren Hartkäse bekannten Region. Der Reporter pflichtet bei: Da könnten nur Schutzzölle helfen. Freihandel sei eine schöne Sache, aber eben nur theoretisch. Frankreich könnte an seiner Freizügigkeit und seiner verfeinerten Zivilisation sterben wie vor ihm Ägypten, Griechenland, Rom - denn "der Franzose ist mehr als liberal, er ist generös!".
Kulturgeschichtlich sind diese Reportagen bei aller Voreingenommenheit und Information aus zweiter Hand eine Trouvaille. Sie lassen den Wechsel von der Agrar- zur Kommerz- und Industriegesellschaft aus unmittelbarer Anschauung nachempfinden und sollten einführende Pflichtlektüre sein für wissenschaftliche Monumente wie Eugen Webers "Peasants into Frenchmen". Literarisch sind die Texte dieses Bandes, wie Steinfeld einleuchtend zeigt, wertvolle Zeugnisse eines Übergangs, in dem Strindberg sich vom Roman ab- und mit "Die Inselbauern" sich ihm bald schon wieder zuwandte. Steinfeld hat die 1920 erschienene und längst vergriffene deutsche Fassung des Texts kritisch durchgesehen. Fast bedauert man, dass kein Verlag es damals dem Autor ermöglichte, etwas länger bei seinem Reportageprojekt zu bleiben und es, wie er es vorhatte, auch auf Italien, England oder Deutschland auszuweiten.
JOSEPH HANIMANN
August Strindberg: "Unter französischen Bauern". Eine Reportage. Deutsche Fassung von Emil Schering. Mit einem Essay von Thomas Steinfeld. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2009. 261 S., geb., 25,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
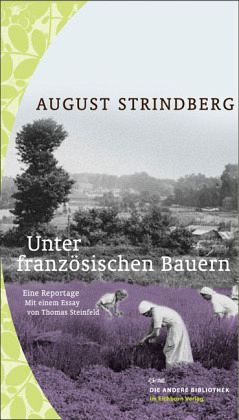





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.05.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.05.2009