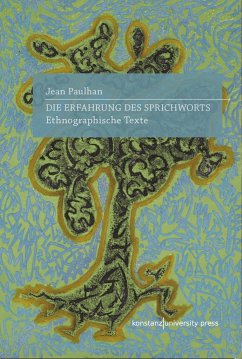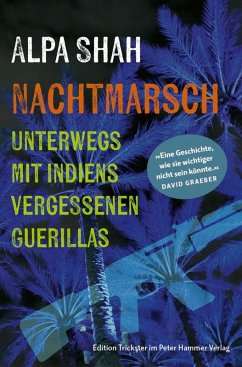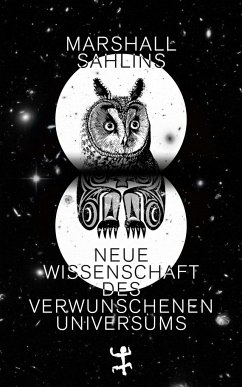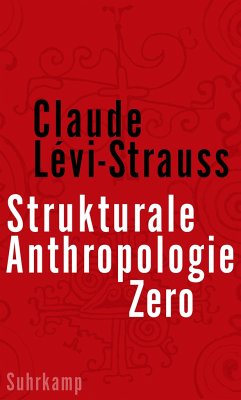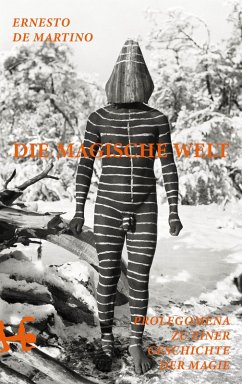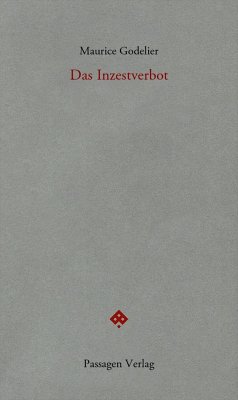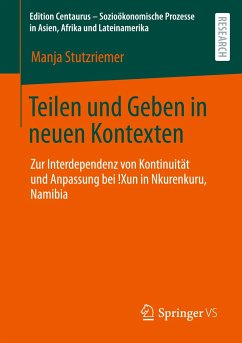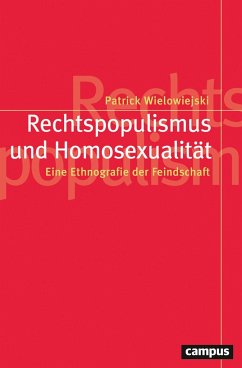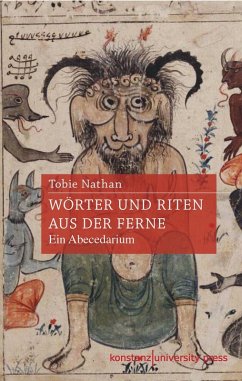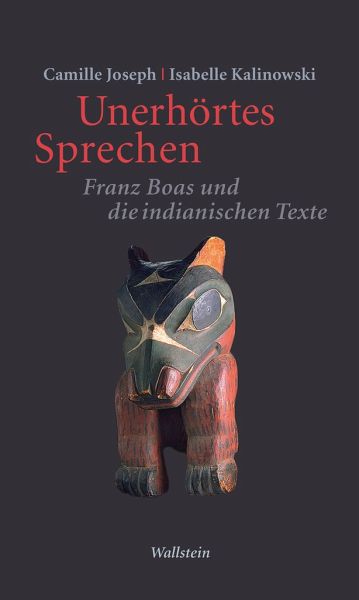
Unerhörtes Sprechen
Franz Boas und die indianischen Texte
Übersetzung: Heydenreich, Katrin
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
26,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Warum hat Franz Boas seine bei den indigenen Völkern Nordamerikas gesammelten Texte nicht mehr kommentiert und interpretiert? Camille Joseph und Isabelle Kalinowski lüften ein epistemologisches Rätsel.Franz Boas (1858-1942) gilt als Gründervater der amerikanischen Anthropologie. In den indigenen Gebieten der Nordwestküste sammelte er unzählige Masken, Werkzeuge, Bilder, Skelette, Zahlen und Messdaten, vor allem aber Texte und Sprachen. Nachdem er zehn Jahren als Kurator im American Museum of Natural History (New York) tätig war, hörte er aber plötzlich auf, Gegenstände anzuhäufen. S...
Warum hat Franz Boas seine bei den indigenen Völkern Nordamerikas gesammelten Texte nicht mehr kommentiert und interpretiert? Camille Joseph und Isabelle Kalinowski lüften ein epistemologisches Rätsel.Franz Boas (1858-1942) gilt als Gründervater der amerikanischen Anthropologie. In den indigenen Gebieten der Nordwestküste sammelte er unzählige Masken, Werkzeuge, Bilder, Skelette, Zahlen und Messdaten, vor allem aber Texte und Sprachen. Nachdem er zehn Jahren als Kurator im American Museum of Natural History (New York) tätig war, hörte er aber plötzlich auf, Gegenstände anzuhäufen. Stattdessen veröffentlichte er ab 1905 vor allem Texteditionen, Mythen und Übersetzungen und konzentrierte sich auf Sprachobjekte. Dieser Bruch in seinem Verhältnis zur Materialität sowie seine Editionen, die zumeist ohne Kommentar erschienen, geben Rätsel auf, denen die Autorinnen auf die Spur kommen. Boas` wissenschaftliche Methode, die hier gründlich rekonstruiert wird, richtete sich auf die Möglichkeitsbedingungen der Hörbarkeit von Fremdsprachen: Jenseits allem guten kulturellen Willen stößt der Forscher auf die Grenzen seiner Kompetenz, fremde Töne zu vernehmen, wie Boas in seinem Konzept der »Hörblindheit« zusammenfasste. Seinem lebenslangen Versuch, die Aufmerksamkeit auf feine Variationen zu lenken, ist »Unerhörtes Sprechen« gewidmet.