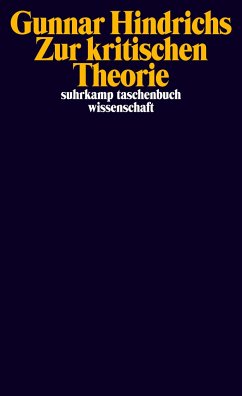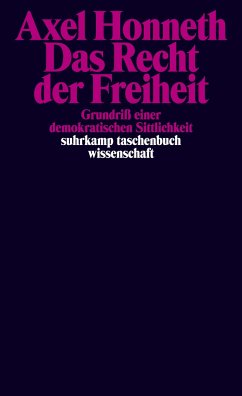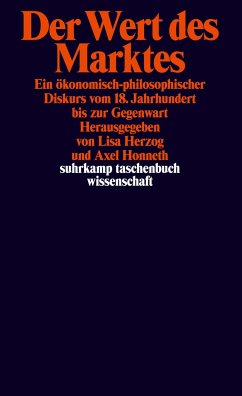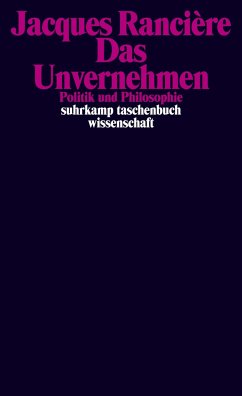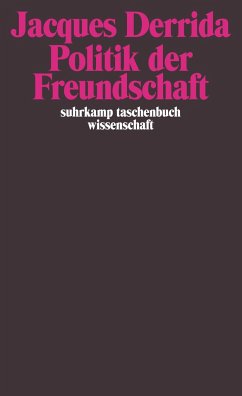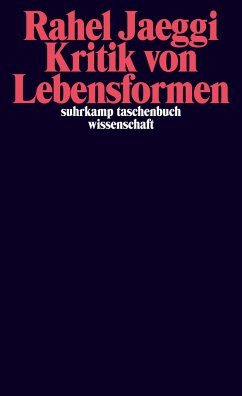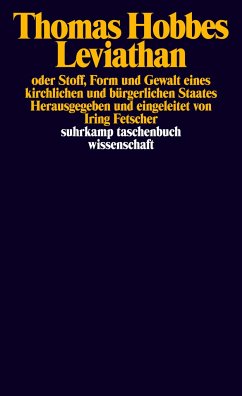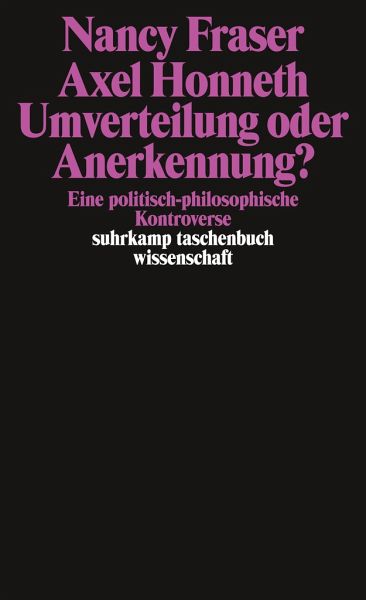
Umverteilung oder Anerkennung?
Eine politisch-philosophische Kontroverse
Übersetzung: Wolf, Burkhardt
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In diesem Band wird jene heute breitgeführte Diskussion fortgesetzt, die sich im Rahmen der politischen Philosophie mit dem Begriff der Anerkennung und seinem Verhältnis zur Gerechtigkeitstheorie beschäftigt. Nancy Fraser vertritt die These, daß eine politisch-philosophische Konzentration auf die Anerkennungsbegrifflichkeit die Folge hat, die nach wie vor brisanten Umverteilungsfragen in den Hintergrund treten zu lassen; demgegenüber möchte Axel Honneth zeigen, daß sich Fragen der Verteilungsgerechtigkeit normativ besser klären lassen, wenn sie im Rahmen eines hinreichend ausdifferenzi...
In diesem Band wird jene heute breitgeführte Diskussion fortgesetzt, die sich im Rahmen der politischen Philosophie mit dem Begriff der Anerkennung und seinem Verhältnis zur Gerechtigkeitstheorie beschäftigt. Nancy Fraser vertritt die These, daß eine politisch-philosophische Konzentration auf die Anerkennungsbegrifflichkeit die Folge hat, die nach wie vor brisanten Umverteilungsfragen in den Hintergrund treten zu lassen; demgegenüber möchte Axel Honneth zeigen, daß sich Fragen der Verteilungsgerechtigkeit normativ besser klären lassen, wenn sie im Rahmen eines hinreichend ausdifferenzierten Anerkennungskonzeptes reformuliert werden. Die durch diese Entgegensetzung gekennzeichnete Fragestellung wirft eine Reihe von politischen, gesellschaftstheoretischen und normativen Fragen auf, die in diesem Band kontrovers behandelt werden.