in Deutschland ist nicht durch Gelehrsamkeit und theoretische Ergüsse, sondern vor allem durch die Praxis, sein geschultes Auge und seine Erwerbsentscheidungen ausgewiesen. Er hat dreißig Jahre gebraucht, um etwa zweihundert Bilder zu sammeln, darunter eine Mehrzahl von Meisterwerken.
Solche Konzentration wirkt wie Askese in einer Zeit, wo Jahr für Jahr Sammlungen mit Hunderten, ja vielfach Tausenden mittelmäßiger und überflüssiger Werke, die allenfalls für den vergänglichen Ausstellungsbetrieb taugen, unsere Museen aufschwemmen und bis zur Unkenntlichkeit verändern. Schmalenbach hat einmal gesagt, die Kunst des Sammelns bestehe nicht im Erwerb, sondern im Nichtkauf, im Abwarten und Verwerfen, ja, im Mut zur Enthaltsamkeit. Hochmütig verfocht Schmalenbach das absolute Qualitäts- und Eliteprinzip. Streitlustig hielt er Abstand zu Experimenten und Avantgarden, scherte sich nicht um kunsthistorische Bezüge, Entwicklungen und Forschritte, um Vollständigkeiten und Bedeutsamkeiten. Er verbrämte seine Erwerbungen nicht wissenschaftlich oder aufklärerisch, verachtete Richtungen, Programme, Trends und Aktualitäten, folgte allein der Augenlust und verließ sich auf seine scharfe sinnliche Intelligenz. Ziel war immer das einzelne, überwältigend schöne, schlüssige, unersetzliche Bild.
Nun hat sich Schmalenbach im Alter einen Wunsch erfüllt - Exkursionen über die Moderne hinaus zu den Wunderwerken der Kunst aus vier Jahrtausenden. Heute, so bekennt er, sei seine Neugier auf das Neue geringer als die auf das Alte. Um seine Erfahrungen mit seinen persönlichen Idolen, seine Dankbarkeit und Begeisterung kundzutun, wählt er die Form des Gesprächs. In zweiundzwanzig Dialogen mit Susanne Henle versucht er herauszufinden und zu begründen, worin sich für ihn Qualität und Wahrheit eines Kunstwerks manifestieren. Besprochen werden Bilder und Skulpturen vom Alten Reich der Ägypter, von den Assyrern, der afrikanischen Stammeskunst, von den byzantinischen und mittelalterlichen Heiligtümern über Mantegna und Castagno, Vélazquez und Rembrandt, Saenredam und Vermeer bis Goya, van Gogh und Picasso. Schmalenbach bekennt sich zur Generation von Tàpies und Chillida mit Wurzeln bei Picasso, Léger, Mondrian. So ist es ein von der Moderne geprägter Blick, der in die Kunstgeschichte schweift und hier ein imaginäres Museum verdichtet.
Die Lektionen sind spannend, auch wenn sie sich bisweilen im präzeptorischen Pathos gefallen. So irritieren die Gesprächseröffnungen, die ersten Auskünfte darüber, was den Autor an den debattierten Werken affiziert. Fast stereotyp ist da von Begeisterung, Glücksmomenten, von Gefühlen des Gepacktseins und der Überwältigung, von Erdbeben und Lebensveränderungen, von "ungeheurer Kraft", "ungeheurer Schönheit", "ungeheurer Form" die Rede. Aber es lohnt sich, über die Einstiegsrhetorik hinauszulesen. Denn die Gesprächspartner tasten sich gemeinsam an künstlerische Kernfragen heran und versuchen die Substanz der Werke, eben ihre Wahrheit zu fassen.
Erwartungsgemäß bekräftigt Schmalenbach die Axiome und Normen der Moderne. Selbstbewußt setzt er, zumal beim Blick auf die ungeliebte Renaissance, sein modernes Auge von dem des neunzehnten Jahrhunderts ab, etwa vom Auge Burckhardts oder Bodes. Zum sakrosankten modernen Glaubensgut gehört die Apotheose der afrikanischen Stammeskunst, von der Schmalenbach noch immer so begeistert ist, daß er in ihrem Namen Donatello, Michelangelo oder Rodin schmähen zu dürfen glaubt. Das reizt zum Widerspruch: Macht man sich ästhetisch verdächtig, wenn man Bernini oder sogar Canova den Afrikanern vorzieht?
Schmalenbach sucht in Kunstwerken nach "Gültigkeit", "Wahrhaftigkeit", "Reinheit", "Ernst", Einfachheit, nach unverstellter Lebendigkeit, geistiger Intensität und formaler Wucht. Er verachtet die Individualisierungen, die Gefühle, die illustrativen Ausschweifungen, die historischen Brechungen und Dekadenzen, kurz die ästhetischen Raffinessen. Den Naturalismus, dessen Sündenfall in seinen Augen schon bei Giotto beginnt, goutiert er nur dann, wenn er restlos in Form aufgeht. Mit den modernen Avantgarden verachtet er Raffael ("lächerlich", "peinlich") und sogar den Rubens der sublimen Ölskizzen ("vollkommen leer"), feiert jedoch den Pathetiker Rembrandt. Er zieht den unbekannten Meister der "Pietà von Avignon" im Louvre Rogier van der Weydens "Kreuzabnahme" im Prado und Castagnos "Abendmahl" der klassischen Komposition von Leonardo vor. Am liebsten würde er sogar die Meisterwerke seiner Idole verbessern: Auf den zentralisierten Gottvater des Genter Altars möchte er ebenso verzichten wie auf das Opferlamm auf Grünewalds Isenheimer Altar oder auf die Figuren bei Caspar David Friedrich. Oder er bedauert, daß die heilige Katharina Caravaggios mit dem Betrachter flirtet. Solche Beanstandungen trägt der Autor natürlich ironisch vor, doch kann er seine moderne Voreingenommenheit und Blickregulierung nicht verleugnen, die das genaue Gegenstück zum akademischen Regelwerk ist, das jahrhundertelang die Kritik benutzte.
Inzwischen wachsen jedoch auch Skepsis und Unbehagen gegenüber Kategorien wie dem "Absoluten" und dem "Ursprünglichen" - zumal angesichts staatstragender Gegenwartskünstler, die in der vierten Generation noch immer wie Urmenschen den Pinsel schwingen und das Holz mit der Axt traktieren.
Schmalenbach weist mit barschem Ungestüm die Erkenntnisdienste der Kunstwissenschaft zurück. Susanne Henle versucht immer wieder, die Apodiktik des Urteils mit kunsthistorischen Argumenten zu mildern und zu korrigieren. Doch der Autor läßt sich nicht abbringen: Auf imponierende Weise verteidigt er die Unabhängigkeit und Autorität seines Auges. Die Wissenschaft und zumal die ikonologischen Konstruktionen, so heißt es, verderben den Kunstgenuß. Er besteht darauf, daß ihn nur interessiere, was zu sehen ist, und nicht das, "was hinter und über dem Bild steht": "Sie müssen sich gar nichts vorstellen, es genügt, daß Sie sehen, was Sie sehen." Beim Anschauen sei das Vergessen wichtiger als jedes Wissen. Angesichts großer Kunst "will ich nicht einmal das wissen, was ich weiß". Das sind keine leeren Worte. Mit seiner Anschauung erreicht Schmalenbach vielfach eine ungewöhnliche Nähe zum Kunstwerk: Er versteht es, das Auge unmittelbar in Sprache umzusetzen. Das gelingt etwa bei der Erklärung der Faszination ägyptischer Reliefkunst, einer in einer unfreien Kultur aufscheinenden Freiheit: Hier verbinde sich mit hieratischer Strenge die Sensibilität dessen, der die Reliefs gemacht habe. Eindrucksvoll sind die Beschreibungen der "Wahrhaftigkeit" Mantegnas, der formgewordenen Natur bei Konrad Witz, der schweigsamen Leere bei dem calvinistischen Kirchenmaler Saenredam und der hörbaren Stille bei Caspar David Friedrich, der "Silberwelt" der "Meninas" von Vélazquez, der Schönheit des Schreckens bei Goya. Der Parteigänger der Moderne kann hier über seine Epoche hinauswachsen. So nimmt er sich die erstaunliche Freiheit, Picassos Paraphrasen der "Meninas" als schlimme Entgleisung und Sakrileg zu geißeln: Sein Idol Picasso habe Vélazquez damit "mißhandelt", "klein und oberflächlich" gemacht.
EDUARD BEAUCAMP
Werner Schmalenbach: "Über die Liebe zur Kunst und die Wahrheit der Bilder". Gespräche mit Susanne Henle. Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2004. 224 S., 93 Abb., br., 24,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
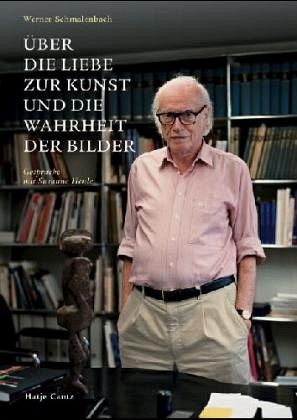










 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2004