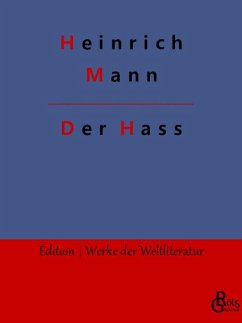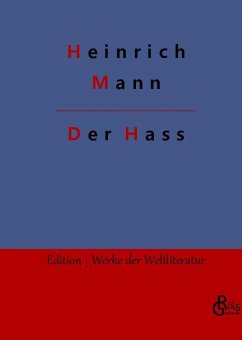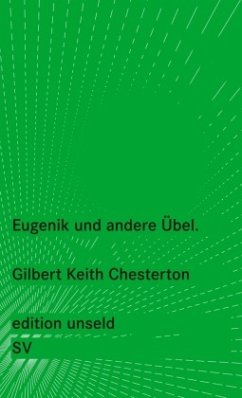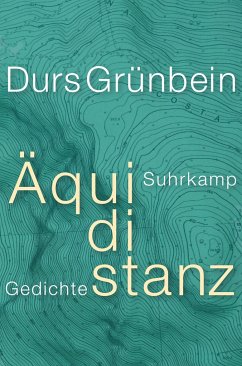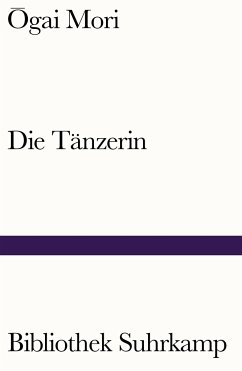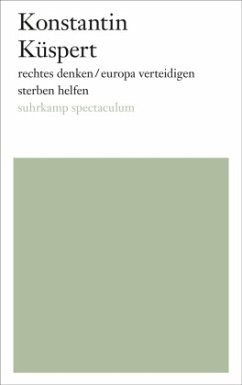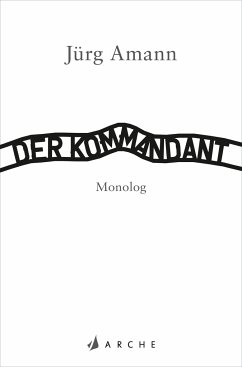"Cahiers", seine Arbeitstagebücher, die 2001 in einer verstümmelten Ausgabe erschienen. An Faszination haben seine Essays und vor allem seine Aphorismen nicht verloren.
Cioran konnte religiöse Institutionen und Glaubenssätze ätzend kritisieren, aber er wollte "nicht in einer Welt leben, die bar jeden religiösen Gefühls wäre", wie im Band "Gevierteilt" zu lesen ist. Das hat kaum zu tun mit dem orthodoxen Pfarrhaus des etwa zwölf Kilometer von Hermannstadt entfernten abgeschiedenen siebenbürgischen Dorfes Rasinari, in dem er am 8. April 1911 als rumänischer Untertan der Habsburger geboren wurde, sondern speist sich eher aus seiner Lektüre christlicher Mystiker.
Allerdings war Cioran in seiner Jugend auch empfänglich für Mystik ganz anderer Art: für jene der faschistischen "Eisernen Garde", aber auch für die nationalsozialistische Mystifizierung von Führer und Nation. Aus den Büchern "Cioran, der Ketzer" von Patrice Bollon (2006 auf Deutsch erschienen) und "Cioran. Porträt eines radikalen Skeptikers" von Bernd Mattheus (2007) kennt man etliche seiner Aussagen über Hitler, doch jetzt kann man sie im Band "Über Deutschland" erstmals in ihrem Kontext auf Deutsch nachlesen. Sie stehen in Artikeln für die rechtsgerichtete rumänische Zeitschrift "Vremea", die Cioran in den Jahren 1933 bis 1935 schrieb, als er sich in Berlin und München aufhielt.
Es fällt auf, dass Cioran schon damals, mit dreiundzwanzig Jahren, über weitläufige Kenntnisse verfügte. So eingehend wie später nie mehr äußert er sich zur Kunstgeschichte - von Dürers "Melancholie" bis zu Bildern von Oskar Kokoschka. Ausführlich geht er auf Hegel ein, aber auch auf die "Psychologie der Weltanschauungen" von Karl Jaspers oder auf Ferdinand Bruckners Drama "Krankheit der Jugend". Auch bei dem Theologen Karl Barth und der Dialektischen Theologie kennt er sich aus.
Und dann diese Sätze: "Es gibt keinen Politiker in der heutigen Welt, der mir größere Sympathie einflößte als Hitler." Oder: "Das Verdienst Hitlers besteht darin, einer Nation den kritischen Verstand geraubt zu haben." Der Artikel endet mit dem Satz: "Wir alle brauchen eine Mystik, weil wir aller dieser Wahrheiten überdrüssig sind, aus denen keine Flammen schießen." Hier zitiert ein überaus belesener Autor einen ironischen Satz Heinrich Heines, "zu fragmentarisch sind Welt und Leben", um sich gegen Heine in die Faszination einer Welt aus einem Guss zu stürzen. Cioran ist sich dabei sogar noch seiner Widersprüche bewusst: "So kannst du an allem zweifeln und dennoch für die Diktatur sein." Doch es kommt noch schlimmer: Nach der Ermordung von Ernst Röhm und anderer SA-Funktionäre durch das Nazi-Regime schrieb Cioran: "Solchen Menschen das Leben zu nehmen, das Blut solcher Bestien zu vergießen, ist eine Pflicht."
Gewiss, Cioran war damals noch jung. Schon drei Jahre später, 1937, schlägt er ganz andere Töne an: "Um in Deutschland nicht vom Hitlerismus vergiftet oder angesteckt zu werden, habe ich begonnen, den Buddhismus zu studieren." Dennoch kommt man um die Frage nicht herum, wie weit Ciorans antidemokratischer Irrationalismus eigentlich reicht. Schließlich beruft er sich auf einen "Kult des unüberlegten Lebens".
Der Blick auf das später entstandene französische Werk zeigt aber klar, wie Cioran nach der Abkehr von seiner Hitler-Faszination sein ganzes Denken umbaut. Man kann es geradezu an einzelnen Begriffen ablesen: "barbarisch" mutiert von einer enthusiastisch positiven zu einer abwertenden Vokabel; der verachtete "Stil" wird für Cioran, seit er Ende der dreißiger Jahre in Paris lebt, zum "Privileg jener Menschen, die in keinem Glauben Ruhe finden"; "Prophet" und "prophetisch", positive Schlüsselwörter des jungen Cioran, sind später mit Verachtung belegt. Auch wenn man Patrice Bollons Ansicht, Ciorans ganze spätere Philosophie sei eine einzige lebenslange Auseinandersetzung mit seinen Jugend-Irrtümern, für überzogen hält, ist doch festzuhalten: Ciorans radikale Skepsis, seine "Übung in Entfaszination", hat etwas zu tun mit den Faszinationen seiner Jugend.
Zwar irritiert, wie Cioran mit seiner Vergangenheit umging: Zeigt sich in den privaten "Cahiers" durchaus Distanz, so spielt er öffentlich seine ehemaligen politischen Überzeugungen herunter oder greift in Neuauflagen früherer Schriften korrigierend ein. Doch offener als sein Landsmann Mircea Eliade, der in den rumänischen Faschismus wesentlich länger und intensiver involviert war, ist er mit seiner Vergangenheit allemal umgegangen. Allerdings fehlen ihm die Kriterien, sie zu analysieren - wie für politische Aussagen überhaupt, denn er kennt nur Nationen als politische Subjekte. In dieser Hinsicht kam er über Oswald Spengler nie hinaus. Die Verschiebung der Gewichte von der Mystik zu der von Anfang an vorhandenen Skepsis ist eine produktivere Auseinandersetzung mit den eigenen Irrtümern als schneller Widerruf oder oberflächliche Reue. Wer sich auf Ciorans bohrende Skepsis einlässt, der muss einige Überzeugungen neu in Augenschein nehmen. Schon darum lohnt es sich, ihn zu lesen.
CORNELIUS HELL
E. M. Cioran: "Über Deutschland". Aufsätze aus den Jahren 1931-1937.
Aus dem Rumänischen und mit einem Nachwort von Ferdinand Leopold. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 232 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
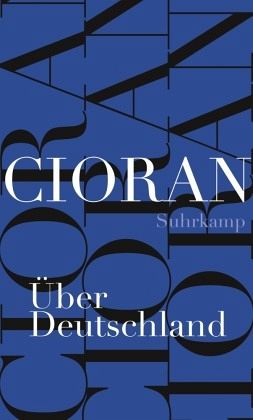





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.04.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.04.2011