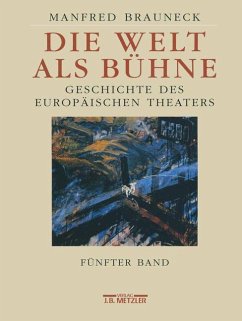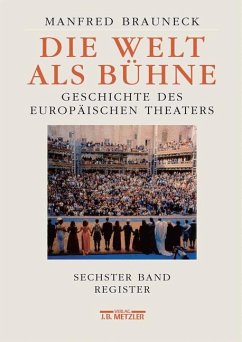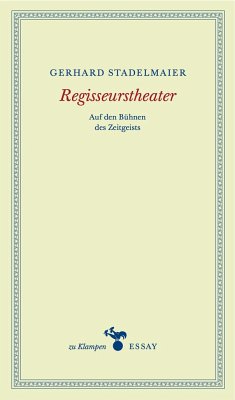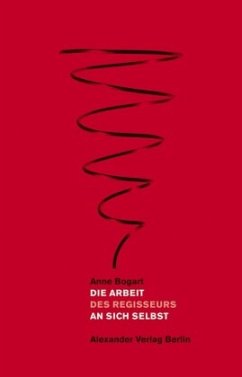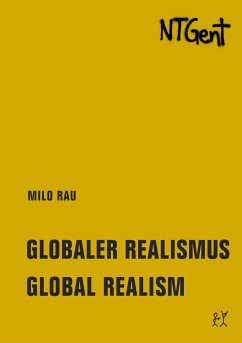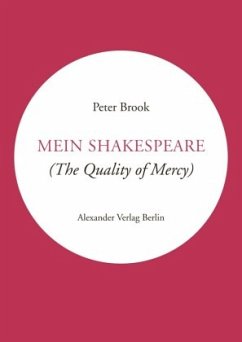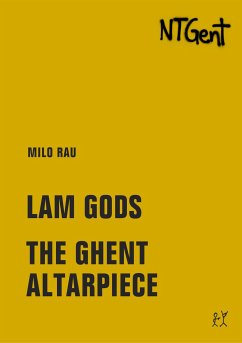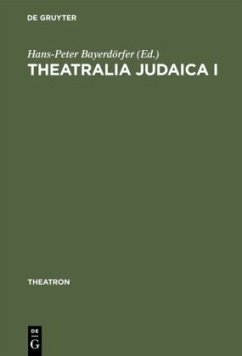es offensichtlich zu machen, das heißt: es zu analysieren. Um Richard Wagner zu verstehen, seine Zeit zu vermessen, zu ermessen - wie seine Bühne. Das aber meint auch: Welt verstehen.
Das geschieht hier mittels der Instrumente der Literatur- und Kulturwissenschaft, auch der Musikwissenschaft; und kraft jener Technik, die von Wien ausgehend die ganze zivilisierte Welt zu ihrem Objekt machte: die der Aufdeckung des Unbewußten und seiner Tiefendimension im Unterbewußten.
So löst sich hier denn aus dem dissonanten Chor, wie er derzeit den Grünen Hügel und den Alten vom Berge umschrillt, eine klare Einzelstimme und führt von Bayreuth nach Wien, von Wien in alle Welt. Führt von scheindramatischer Aktualität hin zu jener Moderne, die, abgelöst vom Epochenbegriff, auch unsere Zeit noch ist, auch wenn die sich lieber im Post begreift: sie bleibt doch angelehnt an jede Geschichtsphase, der sie selbst in der Negation ihren Rechtstitel verdankt.
Drei große Blöcke, oder, um in der vorgegebenen Metaphorik zu bleiben: drei Akte. Auch sie der Bühnensprache verpflichtet, nämlich "Kulisse Wien"; "Drama Liebe"; "Fundus Bayreuth". Diese "Szenarien" (des Untertitels) setzen sich zusammen aus Aufsätzen, Bucheinleitungen, aus Vorträgen. Vor allem aus Vorträgen, hier nun aus der mündlichen, dem Anlaß verpflichteten Form transponiert in die feste Fassung des geschriebenen Essays. Der Rezensent erinnert sich an einige der Auftritte, so in Berlin, in Frankfurt, in Badenweiler, und seine Erinnerung freut sich einer Zeugenschaft, die nicht Gefahr läuft, ihn in den Bannkreis der Befangenheit zu locken.
Zur Sprache. Da ist - Gene hin und Genom her - ein deutlicher Generationensprung zu registrieren: Wo der Urgroßvater im Banne seines histrionischen Temperaments mit gauklerischer Intensität seine Dichtungen und Schriften vortrug, auch wohl, falls nützlich, die Gesangsstimme zu Hilfe nahm, da steht die Urenkelin am Pult wie unter einem Glassturz, streng ihre Texte skandierend, verzichtend auf die hilfreichen Winke aus dem Fundus rhetorischer Finessen, und Dynamik beschränkt sich auf gemessenen Wechsel von Spiel- und Standbein. Und dies bei peinlicher Meidung des persönlichen "Ich". Die Haltung aber, die Form ist schon die Sache selbst, will sagen, diese Sache hat durchgehend die Tendenz, nach einer Einführung, die stoffgebunden erzählt und darstellt, der Anstrengung des Begriffs zuzustreben, der intellektuellen, auch philosophischen Denkübung im Stile eines kühlen Enthusiasmus. Der schriftfixierte Prosastil der Autorin ist somit das präzise Gegenbild der theoretisierenden Suada des Meisters, dessen Perioden ungeachtet ihres oft bedeutenden Inhaltes sich "mährend" fortlaichen, unsinnlich verklemmt und munter Staub absondernd. Hier hingegen erfährt man dankbar die Gabe des reinen Stils, des treffenden Wortes, des apte dictum in eleganter Wendung, die sich auch der sperrigen Materie anmutig annimmt und das dunkle Wort transparent macht und dem Gegenstand im Crescendo und Diminuendo, im Ritardando und Martellato die seinem Wesen gerechte Dynamik entnimmt. Ein Beispiel für viele, über George Sand: "Eine ,Grande amoureuse', man denke nur an Alfred de Musset und Frédéric Chopin, eine Freundin bedeutender Männer, man denke nur an Eugène Delacroix, Heinrich Heine, Franz Liszt, Honoré de Balzac, Charles Sainte-Beuve und Gustave Flaubert, eine Amazone zu Pferd und eine Löwin der Feder, eine erste Suffragette und eine Frau, die als Mann lebte, Männer bezahlte und unter männlichem Pseudonym ihren Lebensunterhalt verdiente, eine Zwittergestalt, ein ,Scheinmann' (Helene Deutsch) und doch den großen Frauen des neunzehnten Jahrhunderts zugehörig - Madame de Staël und George Eliot, den Schlegel-Frauen und den salonführenden Jüdinnen in Berlin, den hingerichteten Frauenrechtlerinnen und adligen Ausbrecherinnen."
Traumtheater" meint kein verträumtes Bühnenspiel. Der Terminus ist - wie vieles andere in diesem Buch - Karl Kraus zu danken, er meint den Vorgang, der jenseits der empirischen Realität das Drama des anderen, des "wahren" Lebens in der Klarsicht des Traumerlebens versteht und solche Erkenntnis zur Signatur der Epoche macht. (Freuds fundamentale "Traumdeutung" erschien 1900.) Jener Epoche, die nirgendwo deutlicher und konsequenter ihren Traum lebte, ihn zu Ende lebte, als in Wien. Das neunzehnte Jahrhundert, als es starb, sich seinen Erben anheim-, aber sie nicht freigebend, starb nirgendwo schöner als in Wien. Der Traum, das muß ein Wiener sein, so wie der Tod ein Wiener sein muß, und kein schönerer Totentanz als der im Walzertakt. (Ravel hat ihn zu Ende gespielt.) Im Jahre nach dem großen Börsenkrach, der ein Menetekel war, erlebt die "Fledermaus" ihre Uraufführung (1874), deren sinnberaubte Botschaft "Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist . . ." geradezu zwanghaft ihre Erledigung durch die Psychoanalyse provozierte.
Drei große Akte also. Der erste, im weitesten Sinne inszeniert aus historischen Requisiten, nennt sich "Kulisse Wien". Da liefert schon das einleitende Kapitel, seinen Ausgang nehmend von dem melancholisch-frivolen Caféhaus-Bonmot "Man lebt nicht einmal einmal", ein Privatissimum über das kulturhistorische Phänomen des Historismus. Tut es am Beispiel der "Ringstraße", ihrer Führung und der sie einkleidenden Architektur. Nietzsche und Ranke und Meinecke sind da die Wegbegleiter, im Hintergrund immer die anderen, die Bahr und Schnitzler, Arnold Schönberg, Adolf Loos und Otto Wagner, und jener Mann, dessen gewitzter Geist das ganze Buch durchfackelt, also Karl Kraus.
Der zweite Akt gehört mit dem "Drama Liebe" dem Eros in all seinen - vor allem fatalen - Ausprägungen von George Sand über Casanova bis hin zu "Lulu und Lolita". (In diesem Szenario hätten auch die Ururgroßeltern Bella figura gemacht, die Gräfin d'Agoult und Franz Liszt, aber sie waren ja keine Literatur, sondern gehörten einer minderen Stufe der Realität an, eben dem faktischen Leben.)
Auch der dritte Akt hat terminologisch seinen Platz unter dem Schnürboden des Buchtitels: "Fundus Bayreuth". Er versieht die Autorin mit allen Requisiten, die dazu tauglich sind, das Werk Wagners besser zu verstehen, als er es selber verstanden hat. Besser vor allem als seine Erben, die "Nachwelt" seiner Welt.
Heterogene Partikel, es kann nicht leicht sein, sie ohne Gewalt mit der Idee eines einigenden Bandes zu bündeln. Das Kunststück aber gelingt der Autorin im "Vorwort", das man besser als Summe, also zum Ende liest. Ein Essay vor den vierzehn ihm folgenden Essays, er skizziert die Brüche und Verwerfungen, die Krisen und die Nervenschäden, die Euphorie und die Skepsis, wie sie, gefügig oder widerstrebend, zusammenschießen im Finale dieses finalen Jahrhunderts. Um 1900 werden sie ihrer selbst inne in jenem Wien, "dem deutlichsten Fall der modernen Welt", wie Robert Musil feststellt. Keine überraschende Botschaft, dieses Wien und diese Moderne sind eindrucksvoll mehrfach beschrieben worden, am schönsten von Hilde Spiel und in den Büchern von Karl E. Schorske und von Gotthart Weinberg und Johannes J. Braakenburg. Nike Wagner läßt, diese und andere Forschungen ergänzend, auf ihrer Bühne auftreten, was Epoche machte in jener Epoche, die Dichter und die Musiker, die Traumtänzer und die Traumdeuter.
Als Kernproblem dieser sich als Moderne verstehenden neuen Gegenwart erweist sich das der "Vermittlung": Wie kann das Neue sich deutlich machen zum einen in der Sorge um die Tradition und die Würde des Tradierten und zum anderen in dem Willen zu eben deren Aufhebung? Inmitten der Antinomie von Kultur und Zivilisation, von Seele und Technik, von Geist und Materie? Durch das Gewirr der Linien und Übergänge in den sich andrängenden Versuchen, die Kunst zum Instrument der Vermittlung zu machen, schimmern als Fixpunkte Namen wie die von Weininger und Schönberg und Wittgenstein und Hofmannsthal, von Georg Simmel und Schnitzler - und immer wieder Karl Kraus. Inmitten aber dieses tausendfach facettierten Konglomerats von Aufbruch und Abbruch, von neuen Ideen und neuer Kunst, von alter Melancholie und vertrauter Skepsis: "in einem miesen Männerheim" ein Obdachloser, der sich als Künstler fühlte und der zum Vernichter wurde alles dessen, was Kultur bisher war und sein wollte. Und die auch da, wo sie sich als bürgerschreckende Gegenkultur verstand, imprägniert war von einem zivilisatorischen Urvertrauen. Der Mensch, nicht gut - aber doch ein Mensch. Das alles aber ging mit "Bruder Hitler" dahin.
Dieses "Drama der Moderne" führt Nike Wagner vor, nicht es inszenierend - denn es inszenierte sich ja selbst -, aber es dramaturgisch klärend und ordnend. Führt die unruhvollen und widersprüchlichen Akteure dieses Spiels vor in wechselnden Kulissen und wechselnden Zeiträumen, läßt sie agieren "auf einer Art Simultanbühne", deren Aktionen dem "Traumtheater" zu seiner eigentümlichen Wirklichkeit verhelfen - und zuweilen auch zu seiner Wahrheit. "Wir alle spielen. Wer es weiß, ist klug", so Arthur Schnitzler.
Soviel, dem Vorwort folgend, von Konzept und Idee des Bandes.
Nacherzählung des Inhalts kann nicht Aufgabe einer Rezension sein. Ich begnüge mich, "konstruktivistisch" vorgehend, mit der Vermessung einiger Partien, deren manche das Recht hat, als Teil für das Ganze zu stehen.
Nike Wagner darf uns als eine der verläßlichsten Autoritäten für die zionistische Idee, für das Wollen und Scheitern Theodor Herzls gelten. Seine "politischen Träume" - ein bewegendes Zeugnis für die Geschichte der deutschen Juden und der nichtjüdischen Deutschen, die Geschichte einer einseitigen und also unglücklichen Liebe, mit der endlichen Katastrophe. "Die jüdische Frage", Karl Kraus versuchte sie auszuklammern, und dennoch ist sein "Sprachwerk", die "Fackel" nämlich, "eine riesenhafte Rede über die Conditio judaica". Josef Popper, Schnitzler und Hofmannsthal stehen für die "sexuelle Frage", für die "Psychopathia litteraris", wie Nike Wagner sie analog zur "Psychopathia sexualis" entdeckt. (Sanft beckmessernde Randbemerkung: "Psychopathia litteralis", mit "l" also statt "r", wäre klanglich schöner, vor allem aber grammatisch korrekter.)
Das führt zum Drama "Liebe".
Goethes "Wilhelm Meister", Stendhal ("Le rouge et le noir") und D. H. Lawrence ("Lady Chatterley") - so fremd einander und doch nah, wenn sie die Standesschranken brechende Liebe darstellen, und jeweils ist in dem "Hohen Paar" (Bloch) die Frau die Erhabene - und das Ende nicht gut. (Übrigens könnte man, mit einem "Lieto fine" freilich, hier auch das Muster Cosima-Richard Wagner durchschimmern sehen.)
"Tristan und Isolde". Nachdem Nike Wagner feststellt, daß zu diesen beiden eigentlich schon alles gesagt sei, sagt sie das Ihre, jenseits dessen, was die "Populärwagnerianer" immer schon "begeistert" habe. Luftreitend kühn unternimmt die Autorin den Schritt von Karneol und Tristans Wundlager nach Wien: Des Helden monologisch-selbstmörderisches Wüten als qualvolle Ich-Analyse deutend: "Regression ins Vorgeburtlich-Bewusstlose", "Auflösung ins Flüssige" (des Blutes), Wiederkehr in die Höhle der Geburt (siehe Hans Blumenbergs "Höhlenausgänge").
Die Überlegungen zu Zeit und Alter und dem Ende anläßlich des Weges der Marschallin von der Liebe zur Entsagung, sie schließen, dem Sujet und seinen Helden sehr angemessen, mit der anmutigen Wendung: Es seien "Inszenierungen auf dem Theater Formen des geistigen und seelischen Überlebens . . . Aber wußten wir das nicht immer schon?"
Wir wußten es, vielleicht. Es kommt aber darauf an, es bewußtzumachen.
Karl Kraus sei wie das erste so auch das letzte Wort gegönnt. Er bekannte einst, für sein Leben gern wissen zu wollen, was die Leute mit ihrem erweiterten Horizont wohl anfingen. Die gutwilligen Leser dieses Buches würden ihm die Antwort nicht schuldig bleiben, in die erweiterte Weite blickend von der Ringstraße aus oder vom Grünen Hügel.
Nike Wagner: "Traumtheater". Szenarien der Moderne. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 2001. 332 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
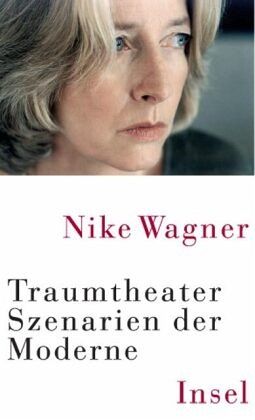




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.11.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.11.2001