Touristenführer auf dem Franklin River, dem letzten ungestauten tasmanischen Urwaldstrom. Gleich zu Beginn erfahren wir, daß ihm eine dilettantisch vorbereitete Expedition zum Verhängnis wurde: Beim Versuch, einen Passagier aus den steigenden Fluten des Franklin zu retten, ist er selbst in einem Felsloch steckengeblieben und wird von reißenden Wassern überschwemmt. Was auf gut 350 Seiten folgt, sind die wirbelnden Visionen eines Sterbenden.
Nicht nur Aljaz' eigenes, aus Enttäuschungen, Tragödien und Niederlagen zusammengestückeltes Leben passiert in diesen Momenten Revue, sondern auch das seiner Vorfahren und das des Territoriums. Unter seiner kühnen Vogelsicht eruptieren Vulkane, Berge werfen sich auf, die Eiszeit kommt und geht, um den Regenwäldern Platz zu machen. Je mehr sich der Sterbende im hellsichtigen Zustand verliert, desto lärmender präsent sind die Geistertiere der Aborigines, unheilige Dämonen, in denen die Seelen machtvoller Toter stecken. Es verlangt einiges an Konzentration, sich in diesen kreisenden Exkursionen durch den Dschungel der Erinnerung zurechtzufinden, auch Courage, um diese Odyssee durch Versagens- und Verlustgeschichten durchzustehen, denn Flanagan läßt keinen Zweifel, daß er von einem verdammten Volk erzählt, dessen Tränen seit langem vertrocknet sind. So ist das Franklin-Hochwasser auch eine Metapher für die aufbrechende Trauer und das Eingeständnis unwiederbringlicher Versäumnisse.
Am Ende seiner Leiden kommt Aljaz in einem sehr irdischen Jenseits an, wo er von den feiernden Toten seiner Familie mit breitem Lächeln begrüßt wird: "Wir haben's, verdammt noch mal, geschafft." Der australische Schriftsteller, der selbst als Flußführer gearbeitet hat und sich in der oralen Tradition Tasmaniens zu Hause weiß, fürchtet sich nicht vor einer sentimentalen Orchestrierung seiner saftigen Moritaten. Es geht ihm um diesen Hafen der verstreuten Geschichten, in dem man weinen und sich auf die Schulter klopfen darf, weil man geläutert auf eigene Erlebnisse zurückblicken kann. Wir hören von Sträflingen, die unter viehischen Bedingungen ihr Leben fristen und sich bei einem verzweifelten Fluchtversuch gegenseitig verspeisen, von barbarischen Holzfäller-Unfällen, von Vergewaltigungen junger Aborigines-Mädchen, von der Entscheidung eines jungen Mannes, sich alle Zähne ziehen zu lassen, um mit dem Erlös nach Tasmanien zurückzufahren und dort in einer Blechhütte von vorn anzufangen. All dem setzt der Autor eine überwältigende Empathie entgegen. Lohn seines erzählerischen Talents ist die Robustheit gerade der lächerlichsten, verkanntesten seiner Figuren. So werden wir Zeuge der Anstrengungen, die Aljaz' von den Ureinwohnern abstammende Großtante unternimmt, um als Weiße durchzugehen. Ihre Wangen sind mit dickem Rouge bedeckt, doch in ihrer Todesstunde wirft sie den ganzen Humbug ab und schickt den katholischen Priester nach Hause.
Magische Ruhepunkte im Mahlstrom des Epos sind all die kleinen, lakonischen Liebesgeschichten, die der Autor seinem rauhen Stoff abringt. Schamlos setzt er die Märchenenergie der Traumzeit-Schamanen ein, wenn es um die Markierung erschütternder Zäsuren geht. Als von Zwillingen einer bei der Geburt stirbt, wächst ein blühender Eukalyptus mitten im Winter über seinem Grab. Das Bettuch, auf das zwei Liebende weinen, weil sie sich in ihrem Stolz verstrickt haben und nicht einer Schwangerschaft wegen heiraten wollen, gibt den Tränenfleck auch nach zahllosen Bleichwäschen nicht wieder her. Der wenig attraktive Aljaz verliert die Beherrschung, als eine Frau ihr Interesse bekundet: "Er war noch nie so begehrt worden, so offen und schamlos. Es erschreckte ihn. Er hatte von solchen Dingen geträumt, er hatte solche Dinge phantasiert, aber als er es wirklich erlebte, war ihm so unwohl dabei, daß er dachte, dabei könne nichts Gutes herauskommen." In den schrägen Liebesszenen, die dann doch dabei herauskommen, gibt es keinen falschen Ton.
"Tod auf dem Fluß" ist insofern ein typisches Erstlingswerk, als es von wilder Sehnsucht, archaischer Grausamkeit und dem Anspruch auf restlose Welterklärung vibriert. An illusionsloser Klarsicht möchte sich Flanagan ebensowenig wie an Trostkompetenz etwas vormachen lassen. Wenn sich die Adjektive gelegentlich kunstgewerblich häufen, tut das der Imposanz dieser Acheron-Herausforderung keinen Abbruch. Richard Flanagans Neuigkeiten von einer der entlegensten Ecken der Welt beweisen erneut, daß die besten Geschichten die der fatalistischen Völker sind: Das Ende ist schon vorweggenommen, und deshalb kann dem langen Atem ihrer Erzählung nichts mehr in die Quere kommen.
Richard Flanagan: "Tod auf dem Fluß". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Peter Knecht. Berlin Verlag, Berlin 2004. 356 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
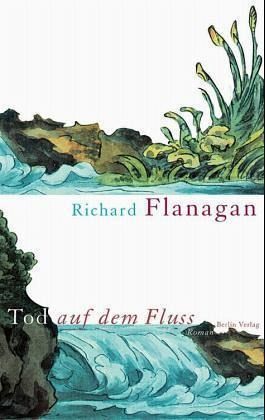



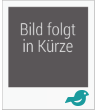

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.12.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.12.2004