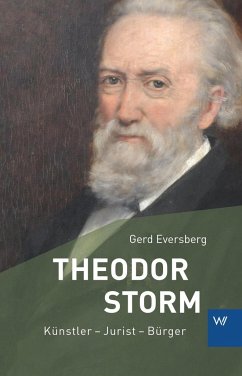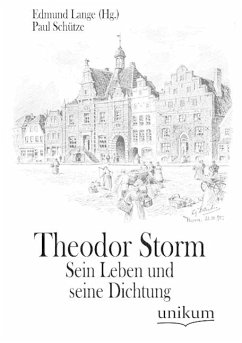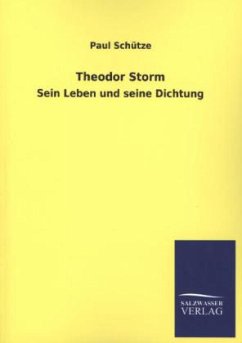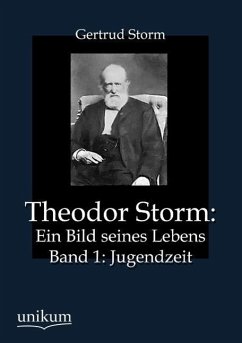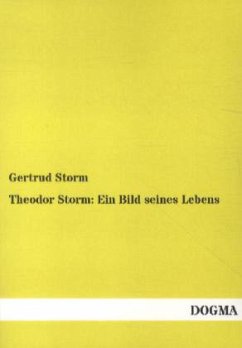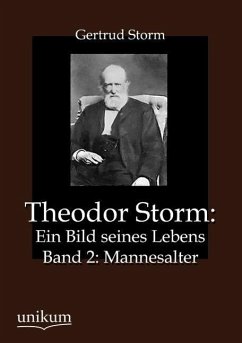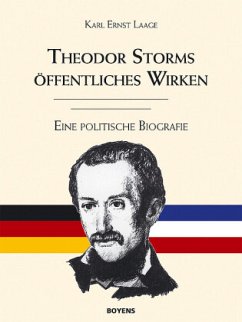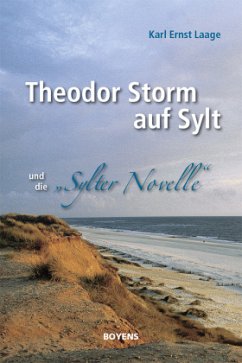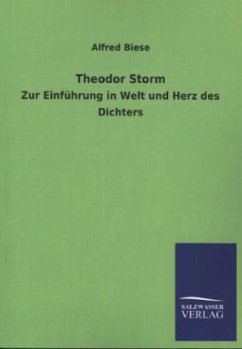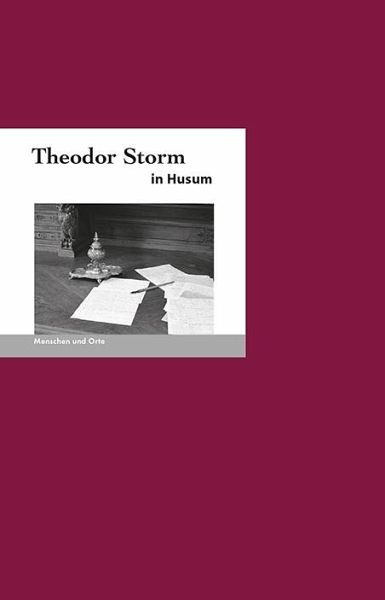
Theodor Storm in Husum
Menschen und Orte 33
Fotos: Fischer, Angelika
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
8,80 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im Jahr 1866 zog der Dichter Theodor Storm mit seiner zweiten Frau Dorothea in das Haus in der Wasserreihe 31 in Husum. Dort wirkte er als Amtsrichter und Landvogt und widmete sich intensiv seinem literarischen Schaffen. Hier entstanden unter anderem seine berühmten Novellen "Viola tricolor", "Pole Poppenspäler", "Draußen im Heidedorf", "Carsten Curator" und vieles mehr, sowie zahlreiche Gedichte.Erst 1885, nach seinem Umzug nach Hademarschen, entstand seine wohl berühmteste Novelle "Der Schimmelreiter". Das Haus in Husum ist noch heute vollständig erhalten und zeigt in großer Authentizi...
Im Jahr 1866 zog der Dichter Theodor Storm mit seiner zweiten Frau Dorothea in das Haus in der Wasserreihe 31 in Husum. Dort wirkte er als Amtsrichter und Landvogt und widmete sich intensiv seinem literarischen Schaffen. Hier entstanden unter anderem seine berühmten Novellen "Viola tricolor", "Pole Poppenspäler", "Draußen im Heidedorf", "Carsten Curator" und vieles mehr, sowie zahlreiche Gedichte.Erst 1885, nach seinem Umzug nach Hademarschen, entstand seine wohl berühmteste Novelle "Der Schimmelreiter". Das Haus in Husum ist noch heute vollständig erhalten und zeigt in großer Authentizität die Atmosphäre in einem Dichterhaus des 19. Jahrhunderts.Das 33. Heft in der beliebten Reihe "Menschen und Orte" trägt wieder einen Umschlag aus farbigem Edelkarton mit einem umgeklebten TIteletikett und wird in einer schützenden Cellophanhülle ausgeliefert.