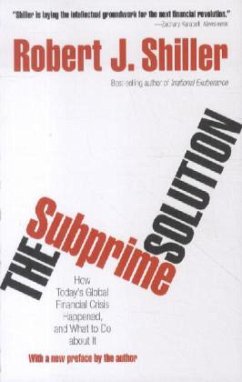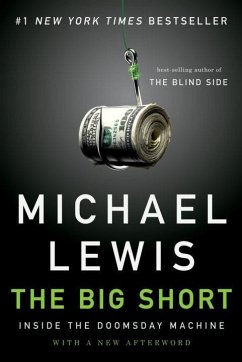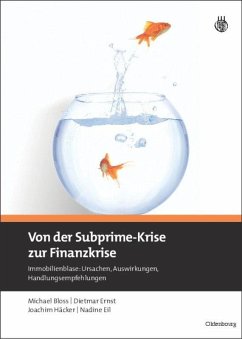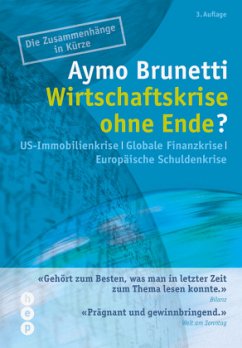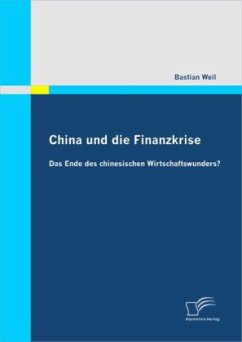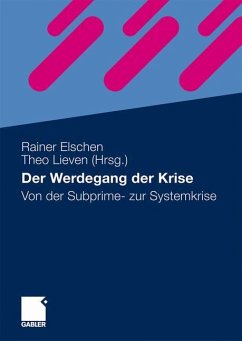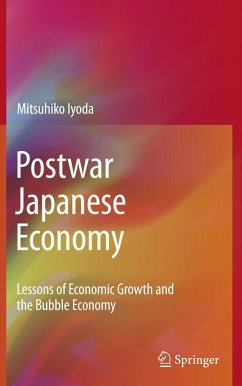Sicht, dass die Finanzbranche in den vergangenen Jahrzehnten viel zu groß geworden ist. Sie vergab viel zu viele Kredite und sorgte auf diese Weise dafür, dass viel zu viel Geld im Umlauf war. Ältere Wirtschaftstheorien hatten für diesen Fall eine hohe Inflation vorhergesagt. Doch die kam nicht. Stattdessen floss das Geld auf den Kapitalmarkt und trieb dort die Preise in die Höhe, bis der Zusammenbruch kam. Die Größe der Finanzbranche macht Zeise schon für die Dot-Com-Krise der Jahrhundertwende verantwortlich.
Eigentlich sei es die Aufgabe der Notenbanken gewesen, dagegen etwas zu unternehmen, findet Zeise. Doch das haben sie nicht geschafft - möglicherweise konnten sie es gar nicht. Nun müsse der Kapitalismus zumindest seine Arbeitsweise ändern, findet Zeise. Am Ende seien die Zentralbanken vielleicht nicht mehr unabhängig.
Wie genau die Wirtschaftsordnung am Ende aussehen kann, verrät Zeise nicht. Stattdessen kritisiert er die kleinteiligen Vorschläge, die noch vor einigen Wochen diskutiert wurden: die Bilanzierungsrichtlinien zu ändern oder die Rating-Agenturen zu reformieren. Das mag nicht jeden interessieren. Doch im ersten Teil des Buches können Leser gut lernen, was in der Krise eigentlich passiert ist - und warum früher zu viel Geld da war, das Geld jetzt aber überall fehlt.
bern.
Das Ende der Party. Von Lucas Zeise. Papyrossa Verlag, 14,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
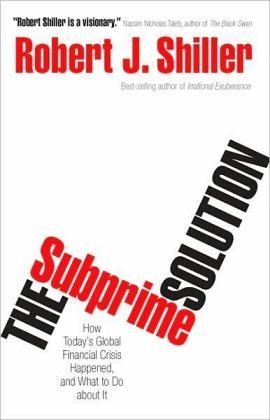





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.10.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.10.2008