zwar für den kleineren.
Die Familie Schwartz, die wir in diesem Buch kennenlernen und einige Monate lang begleiten, ist eine zumindest halbintellektuelle, säkulare jüdische Familie aus der gehobenen Mittelschicht. Religiosität existiert nur als spätpubertäre Sinnsuche der Tochter, die Neigungen zum Katholizismus entwickelt. Der Vater lebt mit seinen beiden Kindern im liberalen Nordosten, in Bellwether (zu deutsch: "Leithammel"), einer fiktiven, relativ wohlhabenden kleinen Vorstadt von einer nicht sehr großen Industriestadt. Die Mutter ist nach der Scheidung nach Nordkalifornien gezogen, um in Berkeley ihr einstmals unterbrochenes Jurastudium zu vollenden, und lebt nun als Anwältin in der Nähe von San Francisco. Bernard Schwartz ist ein Mann in den Vierzigern, der am heimischen Computer "erstklassige Pressemitteilungen für mehr oder weniger professionelle Organisationen" verfaßt. Das Hauptaugenmerk des Romans gilt seinem siebzehnjährigen Sohn Chris. Spätestens als dieser über den "Fänger im Roggen" herzieht, ist klar, daß auch "Eine amerikanische Familie" nicht zuletzt eine Adoleszenz-Geschichte ist, deren Struktur sich aber von J. D. Salinger stark unterscheidet. Mit der jüngeren Schwester Cathy gibt es eine weitere Hauptperson im Teenageralter. Stets wird in der dritten Person erzählt, wobei die Erzählsituation oft in jenen Grenzbereich zwischen auktorialem und personalem Erzählen hineingestanzelt ist, in dem sich nicht klar ausmachen läßt, ob ein Kommentar vom Erzähler oder der gerade in seinem Blickfeld befindlichen Person stammt.
Gleich zu Beginn erleidet Bernard Schwartz einen Schlaganfall und fällt ins Koma. Nach seinem Erwachen findet er sich "auf der geistigen Ebene eines pfiffigen Vierjährigen" wieder. Chris versucht nun, allerdings mit nicht immer tauglichen Mitteln, den Vater wieder an das Erwachsenenleben heranzuführen, in welches er selbst sich gerade hineinzufinden bemüht.
Eine Stärke des Romans besteht in Szenen von beträchtlicher Komik, die nicht selten einen Stich ins Makabre haben, aber zugleich auch recht anrührend sein können. So erscheint zum Beispiel Cathy auf einem Halloween-Kostümfest im selbstgenähten Karmeliterinnengewand, um auf diese Weise ihr Idol, die vom Judentum zum Katholizismus übergetretene, in Auschwitz ermordete Edith Stein, darzustellen. Das klingt geschmackloser, als es im Romanzusammenhang wirkt, weil man als Leser weiß, wie subjektiv ernsthaft die unbeholfenen religiösen Bemühungen des Mädchens sind: "Cathy brachte Stunden damit zu, in ihrem Zimmer aus dem Fenster zu starren und sich nach dem Sinn hinter Edith Steins Tod zu fragen."
Manchmal wirkt die Suche des Autors nach originellen Formulierungen ziemlich verkrampft, etwa so: "Kaum geriet die Gestalt eines seiner beiden Kinder ins Blickfeld, vollzog sich in Bernies Körper ein kardiovaskuläres, autonomes, gastrointestinales, neurologisches, respitatorisches und endokrines Wechselspiel, das der Laie wohl als Liebe bezeichnen würde." Doch häufiger finden sich auch schöne Passagen wie die folgende: "Mondlicht, Lampenlicht und kindliche Projektion verschmolzen auf Bernard Schwartz' Gesicht und ließen Chris die Schwermut, Sehnsucht und leise Furcht seines Vaters ahnen. Chris hatte genug von Bernies rührender, jämmerlicher Hilflosigkeit und ebenso von seinem eigenen unermüdlichen Wunsch, diesem Mann, der ihn stets geliebt, ihm aber nur selten geholfen hatte, zu helfen."
Bei der Charakterisierung der Personen geht Sharpe durchweg zunächst einmal von Klischees aus: Da gibt es einen schwarzen Jugendlichen mit der Wortgewandtheit eines Rappers und seine resolute alleinerziehende Mutter. Ein dumpfer, brutaler, rassistischer Highschool-Footballspieler fehlt ebensowenig wie ein kaum weniger hirnloser, aber gutartiger kalifornischer Surfer, der sich bei alleinstehenden Frauen als Gärtner verdingt, ihnen aber auch gern im Schlafzimmer zu Diensten ist. Beim medizinischen Personal steht einer jungen Neurologin vom Typ, den man früher "Blaustrumpf" genannt hätte, eine nymphomanische "Sprachpathologin" gegenüber. Während Chris alles ironisch kommentieren muß, sucht seine Schwester immer den religiösen Bezug. Erst allmählich, wenn man den Personen näher kommt und immer mehr Einblicke in ihre Gedankenwelt und ihren Gefühlswirrwarr erhält, ergibt sich ein zunehmend komplexeres Bild. Es liegt in der Natur dieses Verfahrens, daß es bei den Hauptpersonen überzeugendere Resultate zeitigt als bei den Nebenfiguren.
Nicht nur, weil gelegentlich übersinnliche Bereiche gestreift werden, sondern auch wegen einiger Unwahrscheinlichkeiten der Handlung erfordert die Lektüre von den Lesern jene "willing suspension of disbelief", die Coleridge einst als Voraussetzung der Dichtung ausgemacht hatte. Zum Nulltarif aber sind wir nicht willens, unsere Skepsis außer Kraft zu setzen. Der Autor muß dafür schon etwas zu bieten haben. Im Falle von Sharpes solide erzähltem Roman sollte vor allem die überzeugende Mischung aus Ironie und Warmherzigkeit Grund genug sein.
Dies ist Sharpes drittes Buch, das erste, das ins Deutsche übersetzt wurde. Es stellt den bisher größten Erfolg des Autors auf dem amerikanischen Buchmarkt dar, wonach es zunächst nicht ausgesehen hat: Von mehreren großen Verlagen zunächst abgelehnt, ist der Roman schließlich bei der kleinen Soft Skull Press in Brooklyn herausgekommen. "Eine amerikanische Familie" reicht nicht wirklich an die Erfolgsromane von Jonathan Franzen oder Jeffrey Eugenides heran. Seine überschaubare Welt legt eher einen Vergleich mit Romanen Rick Moodys, etwa "Der Eissturm", und mit Ang Lees Verfilmung nahe. Einen Regisseur mit ähnlichem Taktgefühl und Stilbewußtsein möchte man auch der laut Klappentext in Vorbereitung befindlichen Verfilmung von Matthew Sharpes Buch wünschen. Zu schade nur, daß Christina Ricci für die Rolle der Cathy mittlerweile entschieden zu alt ist.
HARDY REICH
Matthew Sharpe: "Eine amerikanische Familie". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Verena von Koskull. Aufbau Verlag, Berlin 2005. 336 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
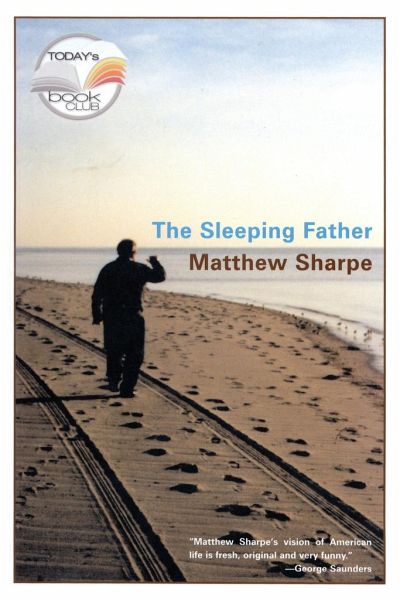






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.06.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.06.2005