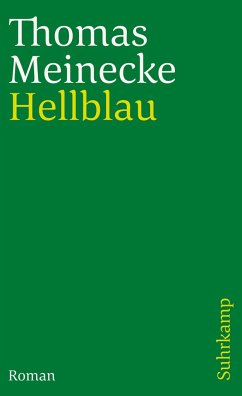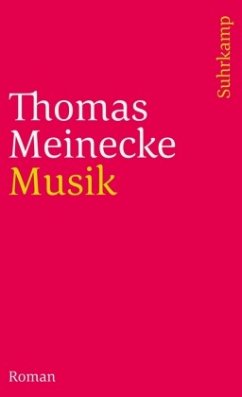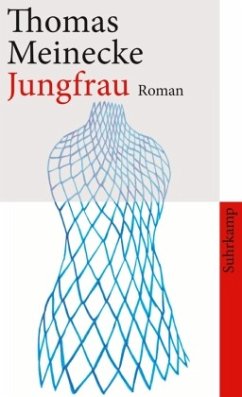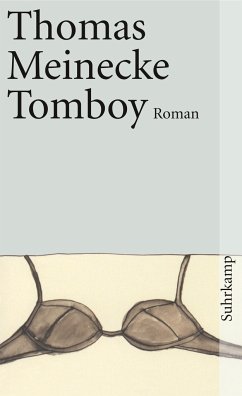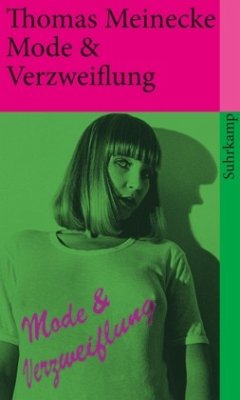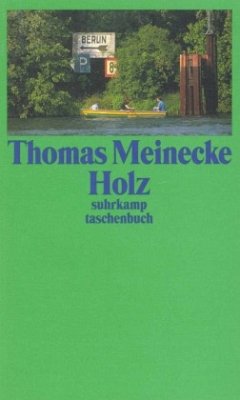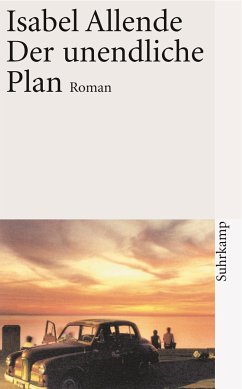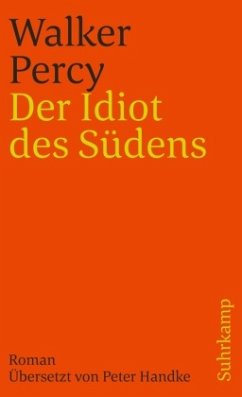verschieden, aber eben noch nicht beliebig. Und den Autoren, die sich darauf einließen, das Etikett ernst zu nehmen: den könnte man heute höchstens vorwerfen, daß sie die Dehnbarkeit des Begriffes unterschätzen. Und seine Haltbarkeit vielleicht auch.
Es mag daran liegen, daß er immer auch Musiker und DJ war, daß Thomas Meinecke besonders gerne über den Zusammenhang zwischen dem musikalischen und dem literarischen Phänomen befragt wurde, und sich nicht weniger bereitwillig darüber äußerte - als Experte gewissermaßen. Das kann, wer heute liest, was unter diesem Label firmiert, kaum noch verstehen: zu spröde ist seine Literatur, zu schwer zugänglich; und eine Beschreibung der scheinbar so banalen Sorgen der Männer von der Straße oder der Frauen aus den Clubs ist sie natürlich auch nicht. Wenn Buchhändler heute ihre Regale neu sortieren, dann mag es schon vorkommen, daß sie Meineckes Suhrkamp-Bände eher unter den Bildungsromanen einordnen. Daß aber der Pop auch damals nicht notwendigerweise dort aufhörte, wo die Hitparade endete; und daß auch heute noch gerne als Tiefe mißverstanden wird, was ein wenig abseits des sogenannten Mainstreams liegt: das waren die beiden Seiten derselben Platte, die Meinecke gerne wahlweise zu wenig Wirklichkeitsbezug oder zu viel Intellektualität bescheinigt haben. An diesem Urteil war, wenn überhaupt, immer nur die Analyse wahr, nie die Wertung: Statt der Oberflächenspannung des Pop hat Meinecke eher die Techniken und Strukturen von Songs und Samples auf die Literatur übertragen. Daß man dazu nicht unbedingt tanzen konnte, spielte nun wirklich keine Rolle.
Als 1996, vier Jahre nach dessen Fertigstellung, sein erster Roman "The Church of John F. Kennedy" erschien, da war es den meisten Fans dieser neuartigen Form vermutlich relativ egal, in welches Genre man den Text irgendwann einmal einordnen würde. Aber sie begriffen wohl schon, daß diese Art zu schreiben etwas mit dem Plattenauflegen zu tun hat: mit der Kunst, vorhandenes Material ungewohnt zu arrangieren und dadurch neue Zusammenhänge zu konstruieren oder auch nur einen schrägen Sound. Und wer dabei trotzdem noch die Figur des (autochthonen) Komponisten beschwor und gegen den DJ verteidigte, der darf zumindest nicht die Musikgeschichte nach einer zeitgemäßen Definition von Kreativität befragen.
Es stimmt schon: Es bleibt nicht sehr viel übrig, wenn man all die Zitate und Paraphrasierungen aus der Geschichte herausstreicht, die der Protagonist Wenzel Assmann da auf seiner Fahrt im maroden Chevrolet von Ellinger, Texas, bis Litiz, Pennsylvania, zusammensammelt. Berichte von den bizarrsten Entwicklungen deutscher Kolonien und Einflüsse, ausgegraben aus Bibliotheken und Privatarchiven; eine Liebesgeschichte mit der viertelindianischen Böhmin Barbara und zaghafte Flirts mit der Amish-Tochter Rachel, die immer gleichfalls Objekt der Studien wie der Begierde sind; abrupt hineingemischte sogenannte Textillustrationen aus alten deutschsprachigen Zeitungen: das reiht Meinecke so übergangslos aneinander, wie es Assmann eben erfährt. Und die einhundert amtlichen westdeutschen Telefonbücher, die neben drei großen Pappkartons mit Studienmaterial ständig im Kofferraum des Mannheimer USA-Reisenden lagern, scheinen nicht nur als Balsam für das Heimweh irgendwelcher Meyers und Shultz' zu wirken, sondern auch als medientechnischer Imperativ eine Verbindung herzustellen, zwischen den Vereinigten und den sich wiedervereinigenden Staaten, zwischen Protestantismus und Katholizismus oder zwischen Links und Rechts. Nur auf den ersten Blick aber sieht das so aus, als ob die Geschichte mit der Zeit genauso auseinanderfällt wie der Wagen. Am Ende nämlich funktioniert beides, weil es nicht nur Pfuscherei ist, wenn einer aus vielen Er- oder eben Versatzstücken etwas bastelt, was sich bewegt: Ein Text, ein Automobil, eine Biographie oder die nationale Identität. Europa, dessen Schlingerkurs durch Einigung und Zerfall Assmann aus der Ferne verfolgt wie es ihn, ging es damals auch nicht viel anders.
stau
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
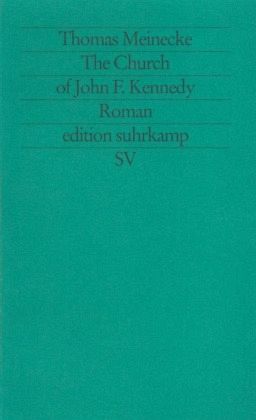




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.03.2002