engagierter Schriftsteller - aber einer, dessen Engagement viel mehr dem Schreiben selbst und dessen Voraussetzungen in der Gegenwart gilt als der aktuellen Politik. Und nun das Zitat: "Hier zum Beispiel, dachte er, als sie an der Kreuzung nach der Tankstelle darauf warteten, dass es grün wurde (Baumarkt, Gartencenter, ALDI), hier links die S-Bahn unterqueren und die Abzweigung Richtung Nordwesten nehmen, ein kurzer Blickkontakt, ein Nicken bestätigten ihm, dass der Kollege auf dem Beifahrersitz (sozusagen) denselben Gedanken hatte, nachvollziehend, was im Kopf (in den Herzen) der Flüchtenden um drei Uhr zwanzig vor sich gegangen sein mochte."
Der Schlüssel zum Verständnis des Romans "Teil der Lösung" - der seinen Titel unausgewiesen einer Parole von Holger Meins verdankt: "Entweder bist du Teil des Problems, oder du bist Teil der Lösung" - liegt im letzten Klammereinschub der zitierten Passage. Generell nutzt Peltzer solche Ergänzungen gerne, um Hintergedanken seiner Protagonisten ans Licht zu bringen, aber hier bedeutet es noch mehr: Der Polizist, dessen Gedanken wiedergegeben werden, weiß, dass es nicht allein der Kopf ist, der die von ihm Verfolgten steuert. Es ist viel mehr noch das Herz, und es ist bezeichnend, dass Pelzer in der Klammer statt der Einzahl den Plural wählt: Der Kopf gehört dem Kollektiv, das Herz einem jeden Einzelnen.
Die Flüchtenden sind eine fünfköpfige Gruppe junger Leute aus Berlin, die in wechselnden Aktionen den Überwachungsstaat sabotieren - jedes Mal ein Stückchen radikaler als zuvor. Zuerst, im Prolog des Romans, schlagen sie dem Sicherheitsdienst im Sony Center am Potsdamer Platz ein Schnippchen und führen dort eine Protestgroteske auf, dann besprühen sie im ersten Teil des Buchs in einer U-Bahn-Station die Objektive der Kameras mit Farbe, provozieren im zweiten Teil die Wachleute im Konsumparadies des Quartier 206 an der Friedrichstraße, und schließlich zünden sie zum Auftakt des dritten und letzten Teils vor dem Ordnungsamt Treptow die Dienstwagen an. "Jede Gesellschaft hat die Feinde, die sie verdient", stellt danach der Sicherheitsdienst-Veteran Klaus Witzke fest, der sich schon mit Terroristen herumgeschlagen hat, als die jungen Protestler des heißen Sommers 2003, in dem Pelzers Roman spielt, noch gar nicht geboren waren. Und entsprechend ernst nimmt Witzke die erst spielerischen, dann fanatischen Aktionen. Das Herz triumphiert über den Kopf - auf beiden Seiten.
Und bei beiden Geschlechtern. Im Zentrum des Romans stehen Nele und Christian, sie eine vierundzwanzigjährige Studentin, er ein siebenunddreißigjähriger freier Journalist. Ihre ersten Begegnungen sind Zusammenstöße in Eingängen - eine der wenigen aufdringlichen Allegorien, die Peltzer benutzt -, doch Christian verliebt sich sofort in die junge Frau, und auch sie kann sich dem Charme der milde verkrachten Existenz des Individualisten nicht entziehen. Angesichts dieser Liebe, für die Peltzer wunderbare Szenen der Intimität geschrieben hat, geraten die eigentlichen Mittelpunkte beider Leben ins Hintertreffen: Nele gehört dem Quartett von jungen Aktivisten an, das bald noch um einen V-Mann des Verfassungsschutzes erweitert wird; Christian recherchiert für eine Reportage über die ausgestiegenen Terroristen der italienischen Linken, die in den achtziger Jahren Zuflucht in Frankreich fanden und denen nun wieder Auslieferung droht.
Herz oder Kopf?
"Zeit, die einem nicht davonläuft, alle Zeit des Sonnensystems. Tage. Wochen. Jahre. Ewigkeit." So empfindet Nele ihre Liebe. Doch dem politischen Projekt bleibt sie treu und reist zu einer Demonstration nach Zürich, wo neben ihr einem Mädchen von einem gepanzerten Fahrzeug der Brustkorb eingedrückt wird. In diesem Moment zerbricht auch etwas in Nele, und der Roman wird zum Protokoll einer verzweifelten Operation - fast möchte man sagen: am offenen Herzen.
Peltzer hat aber weit mehr geschrieben als einen Liebesroman in privat und öffentlich prekären Zeiten, die nach außen ganz harmonisch wirken. Wie stets, wie in "Stefan Martinez", dem Opus magnum von 1995, in dem ein junger Berliner einen Kiez durchstreift, in dem man jede Straßenecke mit höchster Akribie beschrieben bekommt, wie in "Alle oder keiner", dem thematischen Vorläufer von "Teil der Lösung", in dem bereits 1999 die Unmöglichkeit beschrieben wurde, sich als intellektueller Kopf (oder als sensibles Herz) mit dem Zustand der Gesellschaft abzufinden, und wie in der 2002 erschienenen Erzählung "Bryant Park", mit der Peltzer als einer der ersten Schriftsteller auf die Ereignisse des 11. September 2001 reagiert hat (wenn auch erst in einem letzten Textdurchgang durchs bereits fertiggestellte Manuskript) - wie stets also liefert Peltzer eine Momentaufnahme aus extrem subjektiver Sicht. Und in dieser Perspektive, die keinen Zweifel zulässt, liegt die eigentlich politische Tat dieses Schreibens.
Diesmal jedoch gibt es auch die Gegenseite: vier Polizisten, die im internen Wettbewerb ihre Claims abstecken. Und da sind Christians Freunde Jakob und Martin; der erste ein Akademiker, der den Weg durch die Institutionen absolviert hat, der zweite ein psychisch kranker Schauspieler - beides Entwürfe eines Christians unter anderen Vorzeichen. Und da ist als Korrektiv auch Walter Zechbauer, ein nur winzig verschlüsseltes Porträt des Schauspielers Hanns Zischler, der als schillernder Ästhetizist vorgeführt, aber eben nicht denunziert wird.
Dazu wieder einmal Berlin. Berlin in einer Anschaulichkeit, die einem auch ohne konkrete Namensnennung jede Szene wie im Kino vor Augen führt. Peltzer ist ein Meister der atmosphärischen Beschreibung, obwohl nur der geringste Teil des Buches aus solchen Passagen besteht. Sie fungieren als Intermezzi, Ortsbestimmungen, die geographische Grundmelodien Stimmungen erzeugen. Der Rest ist eine Tour de force, auch für den Leser. Recherchen, Schreibprozess und am meisten das Rechtfertigen des eigenen Tuns fordern Ulrich Peltzer mehr Zeit bei der Arbeit an seinen Büchern ab, als man gemeinhin vermuten würde, und für deren Lektüre gilt das Gleiche. Aber sie lohnt sich, wie selten sonst in der deutschen Literatur, weil kein Wort und kein Manierismus hier fehl am Platze ist. Stil ist nicht nur Teil der Lösung des Problems, unsere Gegenwart zu erzählen. Er ist die Lösung. Und Peltzer hat sie.
- Ulrich Peltzer: "Teil der Lösung". Roman. Ammann Verlag, Zürich 2007. 456 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




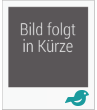

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.12.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.12.2007