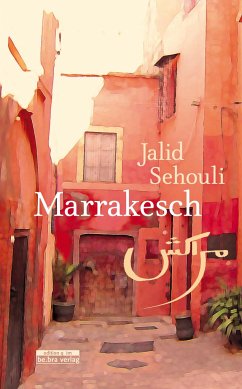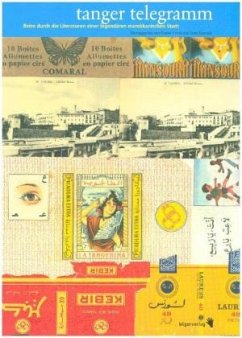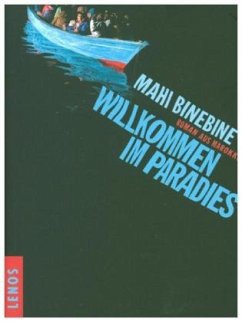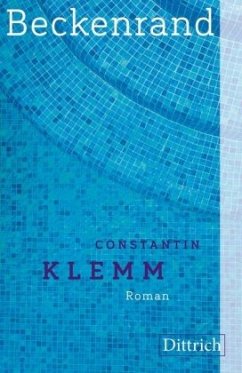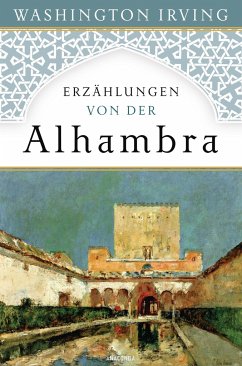habe man die Sehnsucht nach dem Unbekannten ohnehin nur durch Lektüre befriedigen können. Heute, da fast jeder fast überallhin könne, gehe es nicht mehr um die Beschreibung von Schauplätzen, sondern um die "Geschichte dessen, was einer bestimmten Person an einem bestimmten Ort geschehen ist, und sonst gar nichts".
Diese Reisebücher sind subjektiver und literarischer, an die Stelle der von ihren Exkursionen berichtenden Forscher treten reisende Schriftsteller wie Graham Greene, Aldous Huxley, André Gide oder Tanja Blixen. Oberstes Gebot ist jedoch nicht romanhafte Ausschmückung, sondern Ehrlichkeit und Präzision, kein bloßes Verlassen auf Erinnerungen, sondern sorgfältiges Protokollieren des Erlebten. Dazu gehört für Paul Bowles auch die möglichst objektive Darstellung der eigenen Persönlichkeit, eine Art Interpretationsmaßstab, mit dem der Leser "die jeweilige Bedeutung der Details einschätzen kann, so wie in der Legende einer Karte die Größenverhältnisse angegeben werden".
Das damit entworfene Musterbild des Reiseschriftstellers als Landschaftsdeuters und Selbsterkunders erweist sich schnell als akkurater Steckbrief des Verfassers. Der 1910 in New York geborene Paul Bowles war nicht nur einer der großen Reisenden seiner Zeit, seine Erzählungen und Romane wie "Der Himmel über der Wüste" oder "Das Haus der Spinne" gingen oft unmittelbar aus den "Erinnerungen eines Nomaden" (so der deutsche Titel seiner Autobiographie) hervor. In den zwischen 1950 und 1972 für amerikanische Zeitschriften verfassten, von Michael Kleeberg übersetzten und nun größtenteils erstmals auf Deutsch vorliegenden Artikeln hat das Reisefieber einen doppelten Auslöser, ist Flucht und Suche zugleich - Flucht vor der verhassten Heimat Amerika und der Fortschritt und Gleichförmigkeit huldigenden westlichen Welt, Suche nach widerständigen Lebensweisen und vormodernen, archaisch-feudalen Epochen, in die man wie auf einer Zeitreise zurückkehren kann.
Beim Besuch in der alten Königsstadt Fès fühlt sich Paul Bowles ins europäische Mittelalter versetzt, begegnet ungebrochenem Stolz und religiöser Selbstgewissheit, die für technische Errungenschaften, für Mobilität und Geschwindigkeit nur Verachtung übrighaben, als geradezu irrwitzige Versuche, vor dem ohnehin vorbestimmten Schicksal davonzulaufen: "Vielleicht glauben die Franzosen ja, wenn sie nur schnell genug unterwegs sind, wird sie der Tod nicht einholen." Auch die Anhäufung von Geld diene dem sinnlichen Genuss sowie dem Einladen und Bewirten von Freunden. Die gänzliche Abwesenheit von Nervosität, Anspannung und Langeweile gewähre eine Grundzufriedenheit, die dem westlichen Menschen unwiederbringlich abhandengekommen sei.
Gerade das Fehlen veloziferischer Umtriebigkeit und Unrast scheint ein Eintauchen in den langen, ruhigen Fluss des Lebens zu ermöglichen, eine Dehnung des Zeitempfindens hervorzurufen, die (zuweilen verstärkt durch freundlich offerierte Opiate) auch Paul Bowles' Aufenthalte in Nordafrika und Indien, auf einer Insel vor der Küste Sri Lankas oder in der Wüste bestimmt. Nicht schnelles Vorwärtskommen ist das Ziel, sondern langsame Veränderungen und Verwandlungen. Etwa mit dem Flugzeug in die Wüste zu fliegen hieße sich des Zaubers dieser gewaltigen, gleißenden, stillen Einöde zu berauben, in der man die Taufe der Einsamkeit empfangen, das Aufgehobensein im Absoluten erfahren könne: "Es ist eine einzigartige Empfindung, und sie hat nichts mit Verlassenheit zu tun, denn Verlassenheit setzt Erinnerung voraus.
Hier, in dieser vollkommen mineralischen Landschaft, von den Sternen erhellt wie von Leuchtfeuern, verschwindet sogar die Erinnerung; es bleibt nichts übrig als Ihr eigenes Atmen und das Geräusch Ihres schlagenden Herzens." Die eigene Persönlichkeit setze sich dabei völlig neu zusammen, ein Prozess, gegen den man zwar ankämpfen, aber nichts ausrichten könne: "Denn niemand, der längere Zeit in der Sahara war, ist noch derselbe wie bei seiner Ankunft."
Doch die Suche nach Landstrichen, die noch kein Tourist erblickt hat, nach Gegenden, die von der westlichen Kontamination (Claude Lévi-Strauss) noch nicht erfasst sind, wird zum Wettlauf mit der Zeit. Selbst sein Sehnsuchts- und Lebensort Tanger, den er 1931 auf Empfehlung Getrud Steins entdeckte und in dem er 1999 stirbt, erscheint ihm zunehmend vom Virus des Fortschritts infiziert. Den Höhepunkt der systematischen Verdrängung des Alten erlebt Paul Bowles 1965 bei der Rückkehr an die von "Partygirls aus Stockholm und Hamburg" heimgesuchte und von einer "architektonischen Vernichtungswelle" überrollte Costa del Sol, der das zwanzigste Jahrhundert unübersehbare Narben geschlagen habe: Ein Besuch in Torremolinos sei wie der Blick in das Gesicht eines Freundes, der nicht eine, sondern alle Hautkrankheiten zugleich habe.
Schutz gegen das unaufhaltsame Verschwinden bietet nur die Literatur, die lebendige Erinnerung an das, was einmal gewesen sein wird - an Straßen, Plätze und Cafés, an Lichtspiegelungen, Gerüche, Geräusche und Geschmacksempfindungen, vor allem aber an die dieser Atmosphäre ausgesetzten Menschen, die Paul Bowles ohnehin mehr interessieren als alle Sehenswürdigkeiten.
Dass er trotz aller Empathie und Zugewandtheit überall auch Fremder bleibt, sich seines fremden Blicks bewusst ist, bewahrt ihn vor sentimentaler Verklärung und opulenter Ästhetisierung. Vielleicht besteht der Sinn des Reisens ohnehin nicht darin, immer herrlichere Orte zu finden, sondern solche, an denen das eigene Koordinatensystem überprüft, an dem die vertrauten Gewissheiten und kulturellen Prägungen erschüttert und außer Kraft gesetzt werden.
Die meisten Abenteuerlustigen, beklagt Paul Bowles im eingangs erwähnten Essay, verachten Erfahrungen aus zweiter Hand und interessieren sich nicht für Reiseberichte anderer. Dieses Buch sollten sie lesen und sich auf den Weg machen.
MATTHIAS WEICHELT
Paul Bowles: "Taufe der Einsamkeit". Reiseberichte 1950-1972.
Aus dem Englischen von Michael Kleeberg. Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2012. 304 S., Abb., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.06.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.06.2012