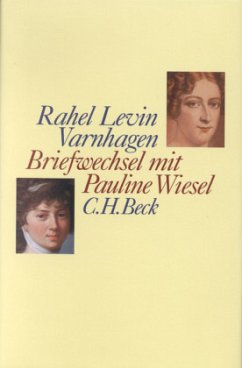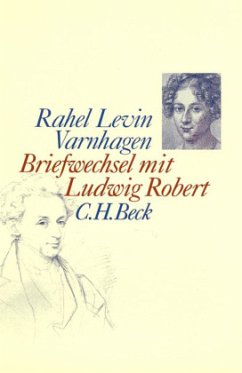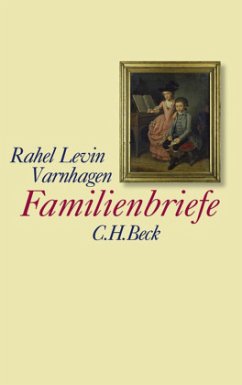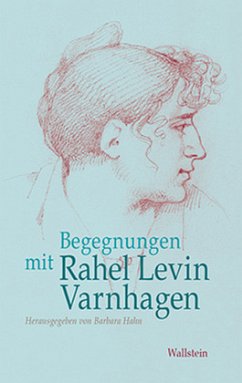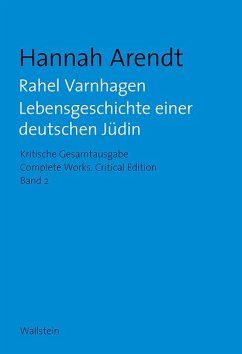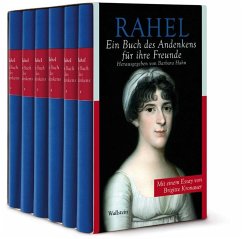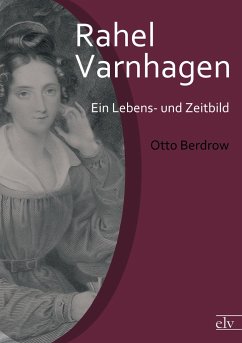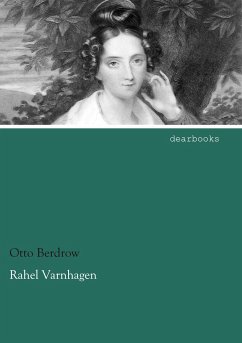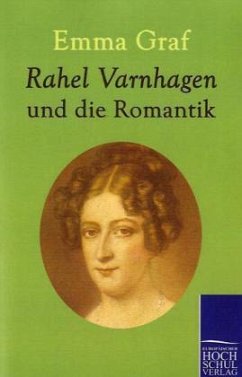Karl August Varnhagen von Ense, der als ehelicher Eckermann diesen wie viele andere Aussprüche festhielt, für charakteristisch halten. Dafür sprechen mehr als sechshundert Seiten funkelnder Einfälle voller Esprit, Ironie und Dialektik.
Neben dem Gatten, den Rahel 1814 heiratete und sich dafür auch taufen ließ, notierten ihre mündlichen Äußerungen auch andere wichtige Gesprächspartner wie Alexander von der Marwitz oder Karl Gustav von Brinkmann, Verfasser eines umfangreichen, später gedruckten Kondolenz-Briefessays. Sie sind in der mustergültigen, mit allen Finessen moderner Editionsphilologie erstellten und mit vierhundert Seiten Kommentar versehenen Ausgabe ebenso enthalten wie sämtliche verfügbaren Tagebuchhefte und losen Blätter aus dem Krakauer Nachlass sowie eine Dokumentation von Anstreichungen und Randbemerkungen in Rahel Varnhagens Büchersammlung. Der Band enthält überwiegend Aphorismen; die Herausgeberin beziffert sie auf neunzig Prozent für die Tagebücher und achtzig Prozent für die losen Blätter.
Als Hannah Arendt 1959 ihre Rahel-Varnhagen-Biographie "Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik" publizierte, die kurz zuvor auf Englisch erschienen war, berichtete sie im Vorwort von dem vor ihrer Flucht 1933 noch genutzten Berliner Nachlass. Ein Vierteljahrhundert später in New York wusste sie nichts von dessen Nachkriegsverbleib, fügte ihrem Buch aber einen umfangreichen Anhang aus Rahels Briefen und Tagebuchaufzeichnungen bei, den sie aus Kopien und Exzerpten rekonstruierte. Damit wollte sie dem deutschen Publikum ein Stück "Geschichte und Physiognomie des deutschen Judentums" vermitteln. Diesem Ziel bringt uns die vollständige Nachlassausgabe - verbunden mit den Gesammelten Werken (1983) sowie den bereits vorliegenden Korrespondenzen mit Pauline Wiesel (1997), dem Bruder Ludwig Robert (2001) und der übrigen Familie (2009) - entschieden näher.
Auch wenn jüdische Themen nicht sehr häufig ausdrücklich vorkommen, wird schnell deutlich, dass diese Aufzeichnungen mit den pietistischen Ursprüngen des Tagebuchschreibens als offenbarendem Seelenbekenntnis nichts zu tun haben. Rahel Varnhagen folgt viel eher der Tradition von Lichtenbergs Sudelbüchern oder den französischen Moralisten - La Bruyère und La Rochefoucauld werden auch verschiedentlich zitiert. Damit geht sie, wie Ursula Isselstein in ihrem klugen Nachwort bemerkt, vom christlichen "Depositum der Geschäfte zum Depositum der Gedanken" über, sie schreibt "Denkblätter" und "Denktagebücher". Rahel Varnhagen liebt "jede Beute" des Geistes, wie sie ihrem Mann einmal schreibt, falls die Einsicht hinterher "das errungene Wissen in lebendigeren Zusammenhang" rückt. Wenn Sophie Mereau oder die Günderode mehr Herz als Kopf waren, dann verhält es sich bei ihr umgekehrt.
Es gibt fast nichts, was das nimmersatte Interesse und die ruhelose Aufmerksamkeit dieser Gedankenjägerin nicht fesseln konnte. Nur manchmal weist sie das allzu Akademische als unwesentlich zurück: Wenn August Wilhelm Schlegel in seiner Vorlesung über Kunst als "durch das Medium des Geistes verklärte Natur" philosophiert, notiert sie sich frech in ihr Heft: "Wer will das wißen?" Auch seine griechischen Säulenordnungen finden nicht ungeteilten Beifall: "Wozu dies Alles? Ich glaube der liest für Maurer." Vor allem die philosophischen Köpfe der Zeit nutzt sie als Wetzsteine ihres kritischen Verstandes: Kant kommt ihr vor, als "dächte er hinter den Worten", Maimon führt sie in bislang verstellte "Rumpelkammern" des Geistes, bei Fichtes Werken fragt sie sich, ob diese, wären sie von einer Frau verfasst, schlechter wären, mit Schleiermachers "dialektischem Geiste" würde sie sich gern "ein Nest aus Platons Stroh" machen, und Friedrich Schlegels Wort vom Historiker als rückwärts gekehrtem Propheten gefällt ihr, weil auch sie Geschichte als Gegenwart zu begreifen versucht.
"In der geringsten Stube ist ein Roman: wenn man nur die Herzen kennt", heißt es einmal. Die "bereits zur Prosa geordnete Wirklichkeit", die Hegel zum Kern des modernen Romans erklärt, lag überall vor ihren Füßen. Sie hat sie aber nicht aufgegriffen, um sie der Poesie des Herzens entgegenzustellen. Was wir jetzt haben, ist aber der Steinbruch dazu, der selbst ein großartiges Stück Literatur darstellt. Rahel Levin Varnhagen zeigt sich darin viel kantiger, kompromissloser und kritischer, als man es bisher angenommen hat.
Rahel Levin Varnhagen: "Tagebücher und Aufzeichnungen". Hrsg. von Ursula Isselstein.
Wallstein Verlag, Göttingen 2019. 1064 S., 16 Abb., geb., 98,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
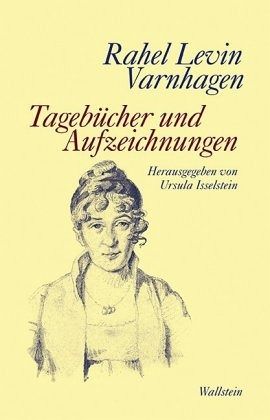




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.11.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.11.2019