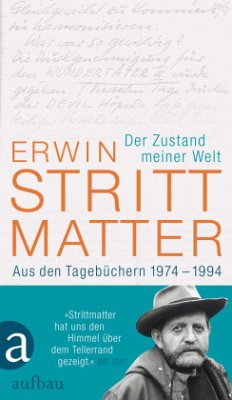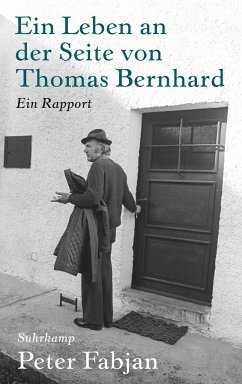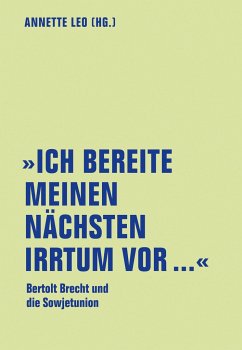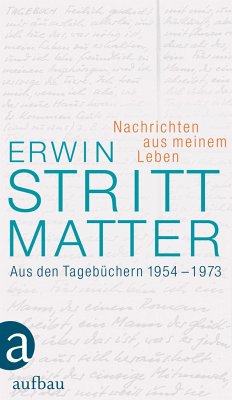Geheimnis mehr. Wenn man die alle gelesen hat, sagt man sich: Nein, ich wollte das alles überhaupt nicht wissen. Und auch den gerade erschienenen vierten Band der Tagebücher Martin Walsers wollte ich unbedingt auf keinen Fall eigentlich lesen. Und fing an und hörte nicht mehr auf. Schrecklich.
Die ersten vier Bände trugen den Titel "Leben und Schreiben", der neue heißt "Schreiben und Leben" und umfasst die Jahre 1979 bis 1981. Der Grund für den Wortwechsel erschließt sich jetzt nicht so direkt. Held und schreibendes "Ich" ist ein Mann, der jeden Tag in seinem Leben schwankt zwischen Mickrigkeit und Größenwahn, Selbstverachtung und Selbstbegeisterung, der in sich nichts als Leere spürt und doch immer nur von sich erzählen will. Ein Held im Taumel der Superlative, der in den klarsten Momenten immer wieder ahnt, dass die wahre Selbstbeschreibung nicht im größten, noch im kleinsten Selbstbild steckt, sondern - in der Mitte. Dass sein Geheimnis die perfekte Durchschnittlichkeit und Gewöhnlichkeit ist. Dass er sich aber da nicht einpendelt, sondern immer wieder vom Gigantismus zum Minimalismus geschossen wird, das hält ihn am Leben und am Schreiben.
Aber immer wieder, plötzlich Erkenntnis: "ICH: Dass alles mit mir zu tun hat, lähmt mich mehr, als es mich schreckt. Es gibt nichts Abschnürenderes als dieses irrsinnige zunehmende Interesse für mich selbst. Dabei weiß ich ganz genau, dass ich dieses Interesse, das ich für mich entwickle, nicht wert bin. Wirklich nicht. Ich bin armselig. Und trotzdem interessiere ich mich für nichts als für mich. Ich bin wirklich langweilig. Ich bewache mich von morgens bis abends. Umsonst. Kein Einfall. Keine Überraschung. Nichts Nennenswertes. Ich gähne aber nicht. Ich bleibe gespannt."
Gespannt auf sich selbst, auf neue, gähnende, innere Leeren, vor allem aber auf neue Frauen, neue "GV"-Möglichkeiten, im Traum oder in der Wirklichkeit. Es ist beachtlich, wo Martin Walser überall Busen sieht, gern werden Kleider beschimpft, die einen tiefen Einblick zu versprechen scheinen, aber den Blick doch nicht freigeben, wie bei Joachim Kaisers Ehefrau. Oder eine Agathe, weil sie im Morgengrauen womöglich zu keinem "GV" zu überreden ist. Mit seinem "Geschlechtsteil", das er praktischerweise, man hat ja auch noch anderes zu schreiben, kurz "GT" nennt. Und Käthe, seine Frau, was sagt eigentlich Käthe dazu? Einmal, als sein Freigängertum offenbar auch den Töchtern nicht mehr verborgen bleibt, notiert er: "Alissas wildes Drängen zu erfahren, ob ich Freundinnen habe oder nicht. Um sie nicht völlig in einer unerträglich falschen, zu günstigen Meinung zu halten, habe ich angedeutet, dass das Sichverlieben wie eine Infektion sei, die nach 14 Tagen von selber nachlasse. Jetzt will sie Namen. Wann zuletzt. Und ob jetzt. Sie fragt Käthe: Das sei ihr egal."
Sie ist tolerant bis zur Gleichgültigkeit, er dagegen natürlich hyperempfindlich wie ein zartes Blümchen im Wind: "Wie Käthe mit mir telefoniert, ist eigentlich ungeheuer. Dieses Tschüü-üs am Schluss klingt, wie wenn eine fröhliche Bekannte einen fröhlichen Bekannten anruft. Sie kann kein Gefühl für meine Empfindungen haben, wenn sie so mit mir spricht." Es ist empörend. Eine freundschaftlich flötende Ehefrau - der Mann ist zu bemitleiden.
Am jammervollsten sind jedoch die Eheszenen, die Walser über seinen Verleger notiert. Das Leben von Hilde Unseld erscheint hier wahrlich als Martyrium, Siegfried lebt seine Liebesbeziehungen aufs offenste aus, die Demütigungen seiner Frau werden nicht verhüllt. Einmal, an Hildes Geburtstag, redet eine Freundin von ihr Siegfried ins Gewissen, "seine Frau sei am Ende, sie könne nicht mehr, das habe sie ihr gesagt". Darauf der Verleger: "Er sei der beste Ehemann in Europa. Das lasse er sich nicht bieten." Was diese Frau ihm antue, das sage er nicht, nur so viel: "Schnarchen tue sie auch." Könnte lustig sein, wenn es nicht so traurig wäre. Oder ist es doch alles eine Karikatur, ein einziger großer Männerwitz? "Frau Merkle, Bosch-Boss-Gattin, wurde bei einer Geburtstagsfeier des Herrn Guth, des Vorstandssprechers der Deutschen Bank, von Siegfried aus Versehen am Busen berührt. Sie rief ihn an, das hat sie erschüttert, fast ein Orgasmus." Äh, ja.
Einmal immerhin sieht sich selbst Walser zum Einschreiten gezwungen, als sein Verleger, betrunken, Geliebte im Arm, das Gesicht seiner Frau, das Aussehen seiner Frau angreift. Sie ruft verzweifelt: "Ich bin 60, was willst du." Unseld: "Dieses Gesicht habe nichts mit 60 zu tun, das hast du deinem Nürnberger Zahnarzt zu verdanken." Die Solidarität der Anwesenden sieht dann so aus: "Wir beteuern, dass sie nicht anders aussehe als sonst."
Der neue Band der Tagebücher Martin Walsers hat natürlich noch viele andere Themen, das hier ist eine arge Verkürzung. Aber wenn man diese Passagen liest, über diese Männer, die den Geist der Bundesrepublik, wie es heißt, literarisch geprägt haben und repräsentieren, da kann man als Leser von heute schon mal die Fassung verlieren. Ja, vielleicht waren die Zeiten auch damals anders, fünfunddreißig Jahre Abstand sind ein ganzes Zeitalter in Fragen der Emanzipation und des Respekts. Aber es war ja nun auch nicht jeder Mann so. Das Traurige an Walsers Betrachtung der Welt: sein Beziehungsbild überträgt er auf die ganze Welt. Wenn Max Frisch in New York ein Loft kauft, um dort mit seiner Geliebten Alice zu leben, und ihm, Walser sagt, später könne sie das mal haben, das Loft, dann kommentiert Walser: "Das ist der Preis. So trostlos." Als müsste auch diese Liebesbeziehung selbstverständlich als Prostitution verstanden werden.
Darüber hinaus wird alles ausgeplaudert, mitgeteilt und aufgeschrieben. Jedes Gerücht, jeder Verdacht. Welcher Kritiker seinem Sohn dringend von einer Heirat abriet, wen er dann zur Abtreibung drängte. Ja, es ist ein lächerlicher, ein spießiger, ein im Grunde literaturfeindlicher Vorwurf gegen das Werk eines Schriftstellers, aber dieses Tagebuch ist auf unangenehme Weise schamlos und frivol. Wie gesagt, erkennt Walser das immer wieder auch durchaus selbst. Als Autoren und Verleger einmal mit Bundeskanzler Helmut Schmidt zusammenkommen und kein rechtes Gespräch zustande kommt, notiert er die Gründe: "Schmidt trocken, konkret, wir verkrampft um Sachen bemüht, als müssten wir verbergen, dass wir keine haben und uns für keine außer uns selbst interessieren."
Die Geschichte der Frauen der Gruppe 47 müsste eigentlich von diesen selbst geschrieben werden. Wie Sofja Tolstaja, die in "Eine Frage der Schuld" ein phantastisches Gegenbuch zur "Kreutzersonate" ihres Mannes Leo Tolstoi geschrieben hat. Eine Heldinnengeschichte. Käthe Walser: Es wäre so toll!
VOLKER WEIDERMANN
Martin Walser: "Schreiben und Leben. Tagebücher 1979-1981". Rowohlt, 700 Seiten, 26,96 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
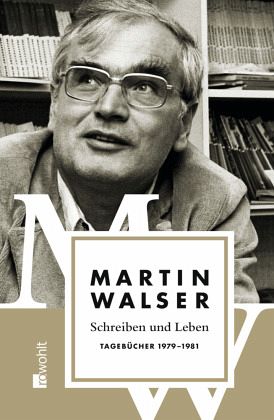





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.08.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.08.2014