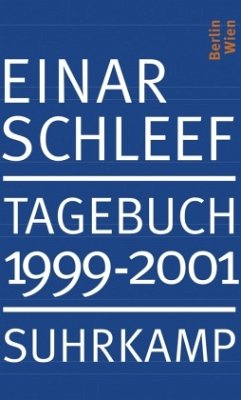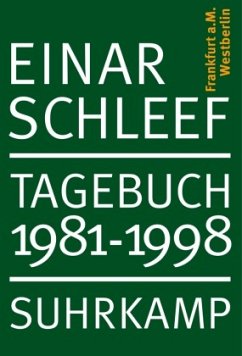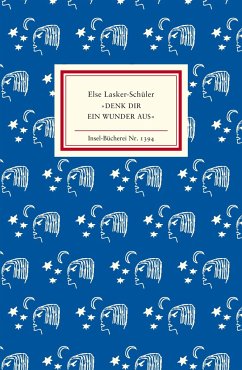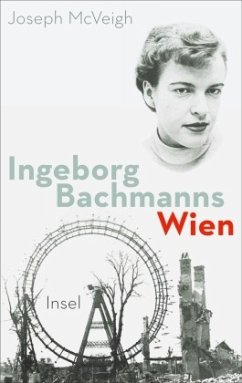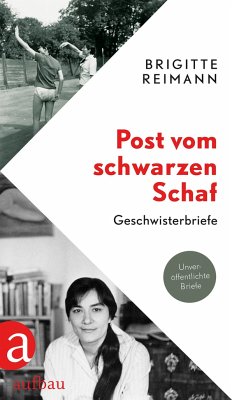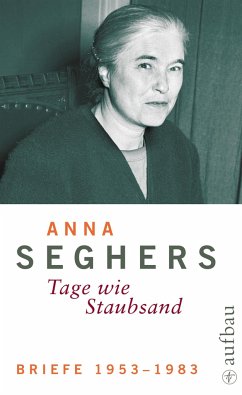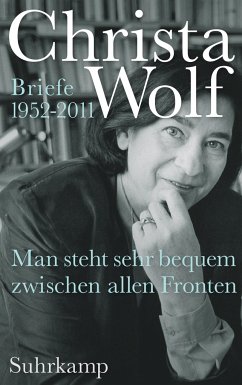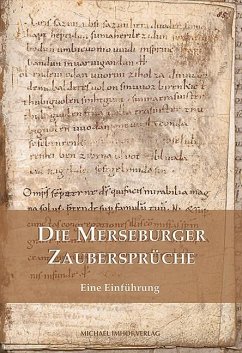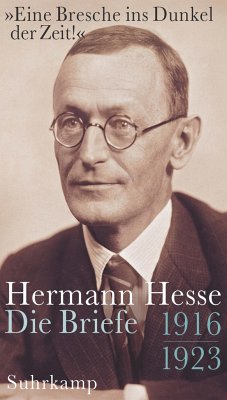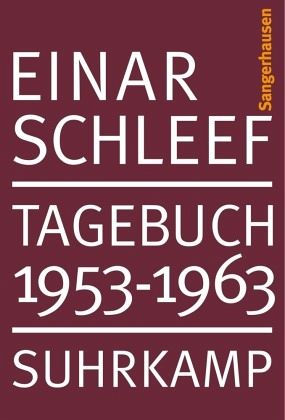
Tagebuch 1953-1963 Sangerhausen
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
38,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Gaswerk, auf dem Bahnhof, vor der Post, auf dem Marktplatz, an den Ausfallstraßen, vor der Maschinenfabrik, vor dem Fahrradwerk MIFA, auf dem Schacht. In unserer Straße. Überall Panzer. Wo kommen die vielen Panzer her?"Wie wird man Mensch, möchte der junge Einar Schleef (geboren 1944 in Sangerhausen) wissen, ganz grundsätzlich, ja exemplarisch. Es geht ums Ganze, und zwar in Sangerhausen, DDR-Provinz, in den Fünfziger Jahren - in denen er sich mit großem Eifer zum Maler ausbildet, in der FDJ mitarbeitet und, um die Eltern zu besänftigen, mit schulischen Leistungen glänzt. Ein schwere...
"Gaswerk, auf dem Bahnhof, vor der Post, auf dem Marktplatz, an den Ausfallstraßen, vor der Maschinenfabrik, vor dem Fahrradwerk MIFA, auf dem Schacht. In unserer Straße. Überall Panzer. Wo kommen die vielen Panzer her?"
Wie wird man Mensch, möchte der junge Einar Schleef (geboren 1944 in Sangerhausen) wissen, ganz grundsätzlich, ja exemplarisch. Es geht ums Ganze, und zwar in Sangerhausen, DDR-Provinz, in den Fünfziger Jahren - in denen er sich mit großem Eifer zum Maler ausbildet, in der FDJ mitarbeitet und, um die Eltern zu besänftigen, mit schulischen Leistungen glänzt. Ein schwerer Unfall hält ihn lange auf der Intensivstation eines Krankenhauses fest. 1963 besteht er die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. 1964 wird er Abitur machen und nach Berlin ziehen.
Das Tagebuch, dessen erster Band hier angekündigt wird, ist kein Fund unter nachgelassenen Papieren, kein Fragment gebliebener, nie zur Veröffentlichung bestimmter Text aus der Jugend, sondern - nach Gertrud (1980/1984) und Droge Faust Parsifal (1997) - das dritte und letzte Hauptwerk des Autors, der daran in den letzten Jahren seines Lebens bis zu seinem Tod am 21. Juli 2001 gearbeitet hat.
Schleef schrieb nicht nur fort, sondern er arbeitete am Tagebuch insgesamt: tippte seine alten Hefte ab, in den Computer und "kommentierte" sie, d.h. er nahm Korrekturen und (häufig umfangreiche) Erweiterungen vor, ließ aber die alten Texte unangetastet. Was entstand, zeigt sich als Doppelgebilde, alte Einträge und neue "Kommentare" bleiben getrennt, sie wechseln einander ab.
Damit nahm Schleef sich die Freiheit, hin und her zu gehen in der Zeit seines Lebens, zu springen. Gegenwart und Vergangenheit geraten an unzähligen Stellen aneinander, es kracht und blitzt: Zeichen eines Kampfs um Wahrheit, den der Autor führt und nur scheiternd gewinnen kann. Er stößt sich an der Natur des Gedächtnisses, den Grenzen seines Blicks, seiner Blockaden. Er geht, soweit er kann.
Schleefs Tagebuch, unbestechliches Zeugnis des Lebens in Ost- und Westdeutschland, ist, wie sich zeigen wird, einer der großen Bekenntnistexte der deutschen Literatur.
Die Veröffentlichung ist auf fünf Bände angelegt. Der zweite Band erscheint 2005 und umfasst den Zeitraum von 1963 bis 1976, dem Jahr, in dem Schleef die DDR verließ
Wie wird man Mensch, möchte der junge Einar Schleef (geboren 1944 in Sangerhausen) wissen, ganz grundsätzlich, ja exemplarisch. Es geht ums Ganze, und zwar in Sangerhausen, DDR-Provinz, in den Fünfziger Jahren - in denen er sich mit großem Eifer zum Maler ausbildet, in der FDJ mitarbeitet und, um die Eltern zu besänftigen, mit schulischen Leistungen glänzt. Ein schwerer Unfall hält ihn lange auf der Intensivstation eines Krankenhauses fest. 1963 besteht er die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. 1964 wird er Abitur machen und nach Berlin ziehen.
Das Tagebuch, dessen erster Band hier angekündigt wird, ist kein Fund unter nachgelassenen Papieren, kein Fragment gebliebener, nie zur Veröffentlichung bestimmter Text aus der Jugend, sondern - nach Gertrud (1980/1984) und Droge Faust Parsifal (1997) - das dritte und letzte Hauptwerk des Autors, der daran in den letzten Jahren seines Lebens bis zu seinem Tod am 21. Juli 2001 gearbeitet hat.
Schleef schrieb nicht nur fort, sondern er arbeitete am Tagebuch insgesamt: tippte seine alten Hefte ab, in den Computer und "kommentierte" sie, d.h. er nahm Korrekturen und (häufig umfangreiche) Erweiterungen vor, ließ aber die alten Texte unangetastet. Was entstand, zeigt sich als Doppelgebilde, alte Einträge und neue "Kommentare" bleiben getrennt, sie wechseln einander ab.
Damit nahm Schleef sich die Freiheit, hin und her zu gehen in der Zeit seines Lebens, zu springen. Gegenwart und Vergangenheit geraten an unzähligen Stellen aneinander, es kracht und blitzt: Zeichen eines Kampfs um Wahrheit, den der Autor führt und nur scheiternd gewinnen kann. Er stößt sich an der Natur des Gedächtnisses, den Grenzen seines Blicks, seiner Blockaden. Er geht, soweit er kann.
Schleefs Tagebuch, unbestechliches Zeugnis des Lebens in Ost- und Westdeutschland, ist, wie sich zeigen wird, einer der großen Bekenntnistexte der deutschen Literatur.
Die Veröffentlichung ist auf fünf Bände angelegt. Der zweite Band erscheint 2005 und umfasst den Zeitraum von 1963 bis 1976, dem Jahr, in dem Schleef die DDR verließ




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.01.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.01.2004