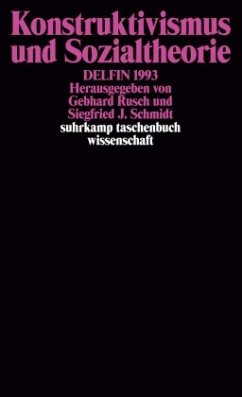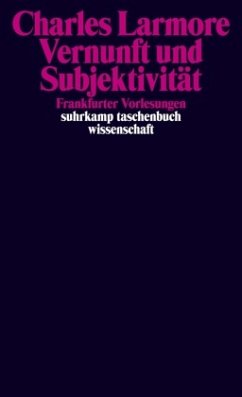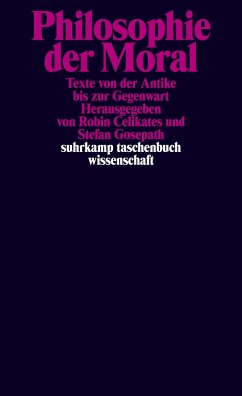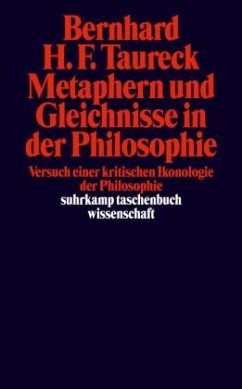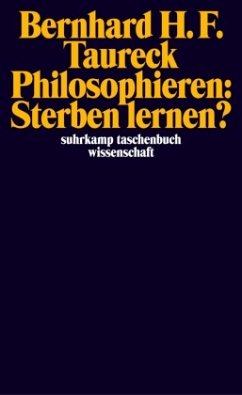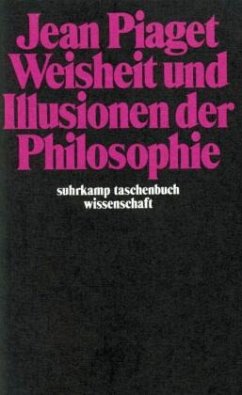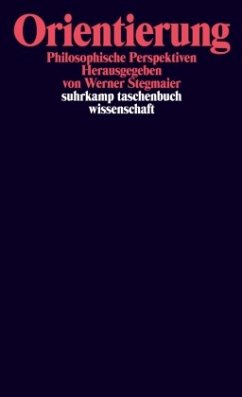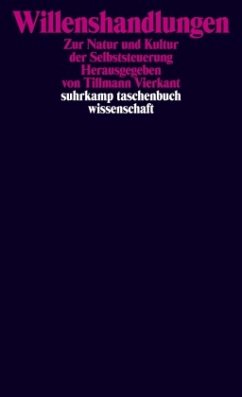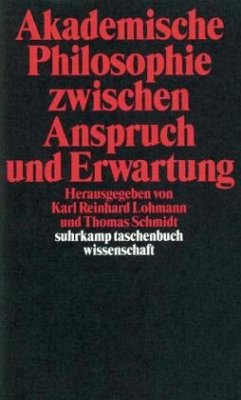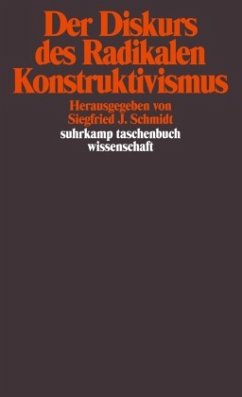neunzehnten Jahrhundert schiebt der Protest gegen das sich als absolute Ordnungsmacht ermächtigende Subjekt den Menschen mit der Unsicherheit seines Lebens, mit seinem hilflosen Ausgesetztsein in einer unbehausten Unordnung in den Blick.
Auf diese Weise wird es Reiner Wiehl zur aktuellen Aufgabe, der systematischen Erkenntnis etwas von der selbstverständlichen Gegebenheit der Welt und der unverfügbaren Existenz etwas von der Freiheit des Subjekts zu retten. Der ursprüngliche Feind heißt Heidegger. Dort werde der viel zu hohe Preis sichtbar, den die moderne Philosophie für ihre scheinbar größere Wirklichkeitsnähe gezahlt habe: "die Anerkennung eines allgemeinen beziehungsweise universalen Unsagbaren und Unerkennbaren durch die universale Vernunfterkenntnis" und "der Verlust der allgemeinen Verbindlichkeit und der objektiven Gültigkeit zugunsten subjektiver Willkür in einer pseudopoetischen und pseudonormativen Sprachgestik".
Nun kennt sich Wiehl bei Plato und Aristoteles, bei Kant und Hegel, in der modernen Anthropologie und Phänomenologie blendend aus und sieht genau, wie die klaren Linienziehungen am Reichtum der historischen Gegenstände immer wieder zersplittern. In der Tat wollen die in "Subjektivität und System" gesammelten Aufsätze zeigen, wie sich bereits bei Aristoteles Sein und Erkennen vielfältig verschränken und bei Hegel Ordnung und Leben; und sie wollen Cohen, Jaspers, Hönigswald, Whitehead als Intermediärgestalten zwischen dem System- und dem Existenzdenken ins rechte Licht rücken. Dennoch bleibt die Philosophiegeschichtsphilosophie der Punkt, an den alles geheftet wird.
Für Wiehl zeichnet die Moderne die Einsicht aus, "daß es nicht nur eine Vielzahl von Welten und eine Vielzahl von Ordnungen gibt, denen ebenso viele Subjekte korrespondieren, sondern daß ein jeweils einzelnes Subjekt zugleich in verschiedenen Welten existiert, nicht nur verschiedene Subjekte in einer gemeinsamen Welt, und daß ein Subjekt nicht nur mit einer und nur einer systematischen Ordnung verlötet ist, sondern sich in verschiedene Ordnungen zu orientieren und zu bewegen vermag, ebensogut wie in verschiedenen Welten". Es wäre eine Aufgabe, diese Einsicht zu explizieren und zu prüfen, wie in einer solchen Pluralität Identität und Verständigung möglich sind. Es wäre auch eine Aufgabe, zu zeigen, daß die aristotelische Wahrnehmungslehre oder Hegels Anthropologie den Zusammenhang von Sein und Erkennen oder von Ordnung und Leben vorbildlich erfassen oder was sie in ihren Synthesen ausblenden.
Mit dem Bemühen aber, diese Aufgaben vor dem Hintergrund einer angemessenen Bestimmung des Verhältnisses des antiken, des neuzeitlichen und des modernen Denkens anzugehen, erweist sich Wiehl als von seinem Feind verzaubert. In den unablässig in sich verschlungenen Versuchen, Ordnung in die vorgängige historische Ausgerichtetheit unseres Denkens zu bringen, versinkt, was doch gerade statuiert werden sollte: die Freiheit des Subjekts, sich begründet argumentierend einer Sache zuzuwenden.
GUSTAV FALKE
Reiner Wiehl: "Subjektivität und System". Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000. 394 S., br., 27,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
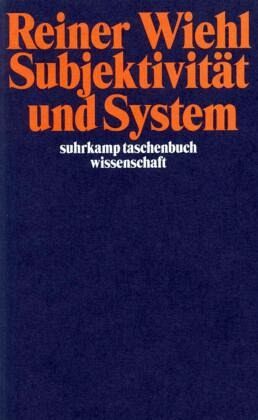




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.05.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.05.2001