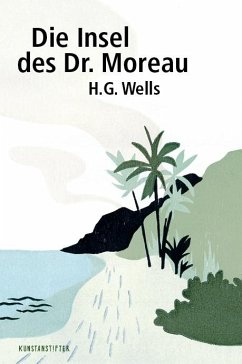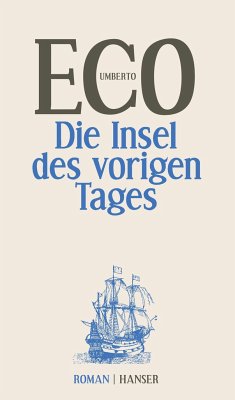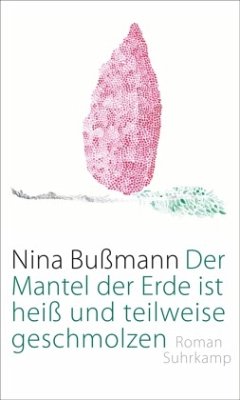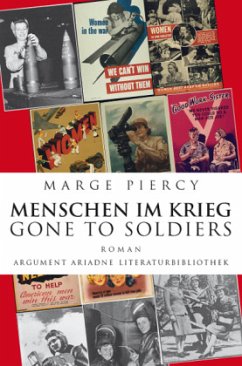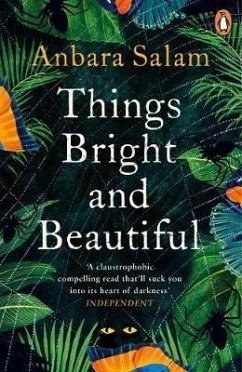Nicht lieferbar
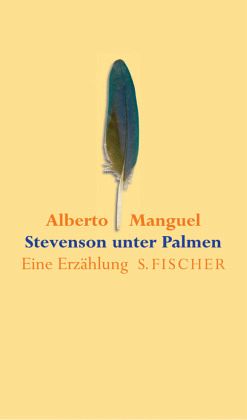
Stevenson unter Palmen
Eine Erzählung
Übersetzung: Hirte, Chris
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
»Liebesbriefe an das Lesen«, schrieb der »New Yorker« über Alberto Manguels Bestseller »Die Geschichte des Lesens«, einem erzählerischen und essayistischen Bravourstück und eine Hommage an eine der schönsten »Möglichkeiten des Glücks« (Borges).Es ist der Traum jedes Schriftstellers, seinem eigenen Tod zu begegnen und so zumindest eine Geschichte lang Macht über ihn zu haben. In Alberto Manguels Erzählung »Stevenson unter Palmen« scheint sich dieser Traum gegen den Autor zu richten. Stevenson, der berühmte Schöpfer der »Schatzinsel« und von »Dr. Jeckyll und Mr Hyde«, hat...
»Liebesbriefe an das Lesen«, schrieb der »New Yorker« über Alberto Manguels Bestseller »Die Geschichte des Lesens«, einem erzählerischen und essayistischen Bravourstück und eine Hommage an eine der schönsten »Möglichkeiten des Glücks« (Borges).
Es ist der Traum jedes Schriftstellers, seinem eigenen Tod zu begegnen und so zumindest eine Geschichte lang Macht über ihn zu haben. In Alberto Manguels Erzählung »Stevenson unter Palmen« scheint sich dieser Traum gegen den Autor zu richten. Stevenson, der berühmte Schöpfer der »Schatzinsel« und von »Dr. Jeckyll und Mr Hyde«, hat sich von den kalten Nebeln Schottlands in die Südsee zurückgezogen. Doch plötzlich begegnet er einem Mann mit vertrauten Akzent, ein Missionar mit harten Zügen. Und es ereignen sich mysteriöse Dinge, in deren Urheber alle Stevenson sehen...
Es ist der Traum jedes Schriftstellers, seinem eigenen Tod zu begegnen und so zumindest eine Geschichte lang Macht über ihn zu haben. In Alberto Manguels Erzählung »Stevenson unter Palmen« scheint sich dieser Traum gegen den Autor zu richten. Stevenson, der berühmte Schöpfer der »Schatzinsel« und von »Dr. Jeckyll und Mr Hyde«, hat sich von den kalten Nebeln Schottlands in die Südsee zurückgezogen. Doch plötzlich begegnet er einem Mann mit vertrauten Akzent, ein Missionar mit harten Zügen. Und es ereignen sich mysteriöse Dinge, in deren Urheber alle Stevenson sehen...