sowie Pan und das Böcklein, deren Reich die Wiese hinter der Hütte des Künstlers ist.
In dieser Welt wächst die namenlose Erzählerin von Renata Serelytes Roman "Sterne der Eiszeit" auf. In ihrer Wahrnehmung verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Phantasie; sie lebt in der dahindämmernden Kleinstadt ebenso wie in einer Traum- und Zauberwelt, die von Wesen aus der antiken Mythologie, Schriftstellern aller europäischen Literaturen und seltsamen Fremdwörtern bevölkert wird.
Der quälenden Bewegungslosigkeit des Landlebens entflieht die Erzählerin in die Hauptstadt Vilnius. Die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt, nach einer Ordnung im Chaos treibt sie um. Halt und Heimat bietet ihr einzig der Engel, der in ihrem Zimmer bei einer Bildhauerswitwe in einer Schachtel mit Baumwollsocken lebt. Doch der Engel entflieht ihr am Ende und hinterläßt einen Abschiedsbrief: "Ich bin keine literarische Fiktion und auch kein Meerschweinchen, dem Du einfach ein Stück Käse hinwerfen kannst. Mir sagen Dein literarischer Geschmack und Deine Manieren überhaupt nicht mehr zu, so daß ich nicht länger mit dir zusammensein will!"
Vertrieben wurde der Engel indes nicht nur von den Manieren der Erzählerin, sondern auch von einer orangenen Mappe mit Manuskripten eines "Sponsors" der Zeitschrift, bei der sie arbeitet. Diese Mappe hat ein diabolisches Eigenleben und treibt die Erzählerin in Erlebnisse, die irgendwo zwischen Fiebertraum und Alkoholdelirium liegen. Nach dem Verlust des Engels wird die Journalistin von einem vegetarischen Dämon geplagt, dessen Herr ein Dresseur ist, der Menschen wie Hunde über das Stöckchen zu springen heißt. Bei Gehorsam gibt es Chappi, sonst eine Rute "so hoch wie der Mount Everest".
Serelyte beschreibt einen Weg vom Land in die Stadt, der prägend ist für mehrere Generationen litauischer Intellektueller. Doch anders als in vielen Werken der traditionellen litauischen Literatur ist das Dorf bei ihr keine Quelle ästhetischer und sittlicher Kraft, kein Ort, an den man zurückkehren kann. Nicht nur, daß der Abschied unwiderruflich ist - das Dorf und die Kleinstadt versinken im Alkohol und sind verkommen, vielleicht sogar verkommener als die Stadt. "Slavikas war einer der Männer meiner Mutter", lautet der erste Satz des Romans, und nur wenige Seiten später wird in einem Nebensatz berichtet, daß ein Vater seinen Sohn "schließlich doch noch zu Tode knüppelte". Als die Erzählerin nach dem frühen Tod der Mutter zu Vater und Großmutter kommt, wird sie von der Großmutter (die dann doch einer der wenigen guten Menschen ist) mit einem einzigen auf sie gemünzten Wort begrüßt: "Häßlich". Die Einsamkeit der Menschen ist auf dem Land nicht geringer als in der Stadt, nur leben sie enger beieinander. "Das Dorf ähnelt von oben einem Geflecht geometrischer Figuren. Und wenn ich ein Gott wäre oder wenigstens ein Mensch im reifen Alter, würde ich vielleicht wollen, daß die Trapeze und Kreise weit voneinander abrücken, sich an den Rändern nicht mehr berühren", heißt es im Prolog des Romans.
Serelyte trifft mit ihrer lyrischen Prosa an manchen Stellen einen überzeugend ins Magische spielenden Ton. Dann gelingt es ihr, das von ihr beschworene Medium in Bildern und Stimmungen zu fassen. Doch oft entgleitet ihr die Kontrolle über Metaphern und Bilder: Unter der Last ihres Übermaßes bricht der Spannungsbogen zwischen realer und jenseitiger Welt. Auf dem Papier bleiben die Bruchstücke ungeordnet nebeneinanderliegen.
Renata Serelyte: "Sterne der Eiszeit". Roman. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2002. 352 S., geb., 21,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
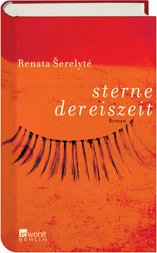




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2002