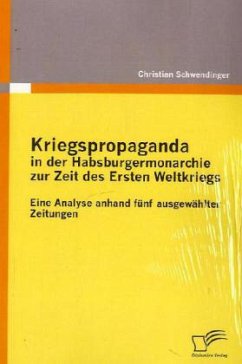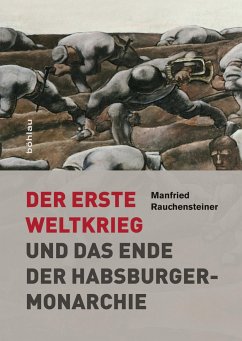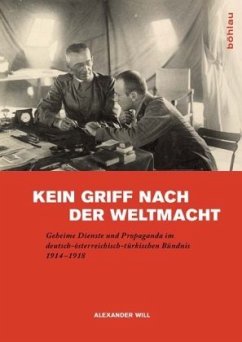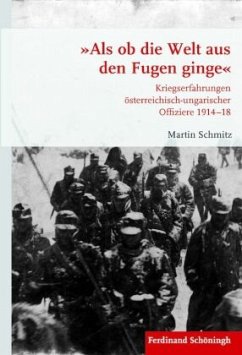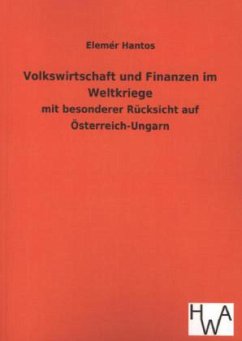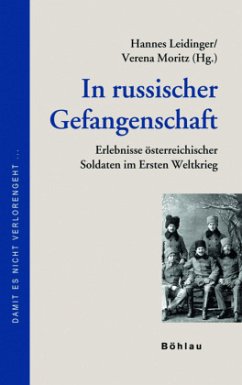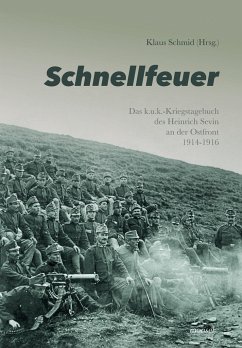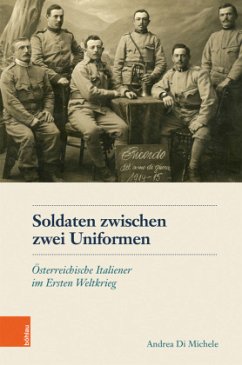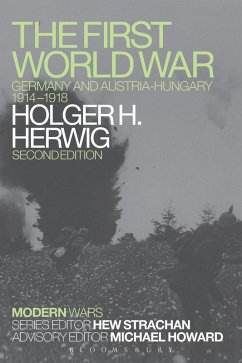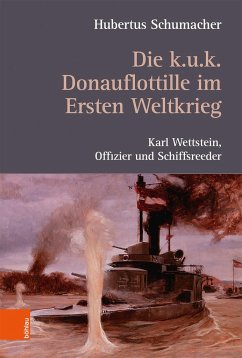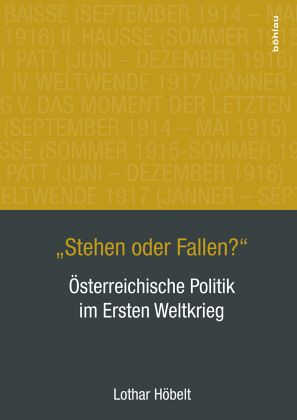
"Stehen oder Fallen?"
Österreichische Politik im Ersten Weltkrieg
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
55,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die larmoyante Perspektive eines zum Untergang verurteilten Reiches wird der österreichischen Politik im Ersten Weltkrieg ebenso wenig gerecht wie das Zerrbild eines willenlosen Vasallen des wilhelminischen Deutschland. Dieses Buch versucht die Politik des Habsburgerreiches in den Jahren 1914/18 - die innere wie die äußere - mit einem kritischen Blick auf derlei Klischees zu rekonstruieren. Politik ist die Kunst des Möglichen: Beim Verhältnis der Nationalitäten zur Habsburgermonarchie handelte es sich nicht um eine Abschiedssymphonie, sondern um eine "Politik der zwei Eisen im Feuer" - d...
Die larmoyante Perspektive eines zum Untergang verurteilten Reiches wird der österreichischen Politik im Ersten Weltkrieg ebenso wenig gerecht wie das Zerrbild eines willenlosen Vasallen des wilhelminischen Deutschland. Dieses Buch versucht die Politik des Habsburgerreiches in den Jahren 1914/18 - die innere wie die äußere - mit einem kritischen Blick auf derlei Klischees zu rekonstruieren. Politik ist die Kunst des Möglichen: Beim Verhältnis der Nationalitäten zur Habsburgermonarchie handelte es sich nicht um eine Abschiedssymphonie, sondern um eine "Politik der zwei Eisen im Feuer" - darum, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, solange der Ausgang des Krieges unsicher war, solange man in den Worten Czernins nicht wusste, ob man "stehen oder fallen" würde - und das blieb so bis zum Spätsommer 1918.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.