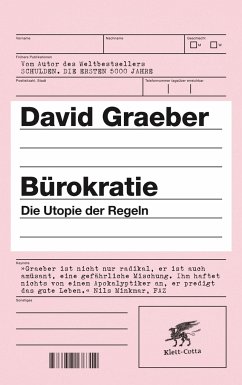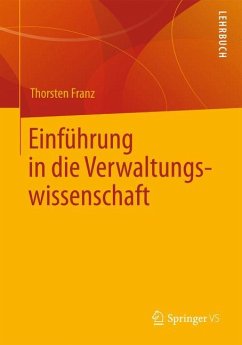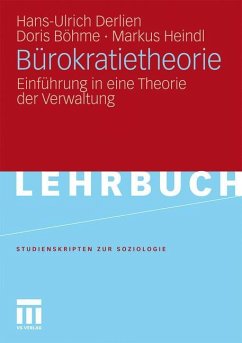müssen, bevor es auch in Deutschland als Problem erkannt wurde: "Stalking" bezeichnet die wiederholte Verfolgung und Belästigung eines Menschen durch einen anderen, und die Übernahme dieses Begriffs aus der Jagdsprache (dort bezeichnet das Verb das "Anpirschen") in den englischen Sprachgebrauch und dann ins Deutsche brauchte tatsächlich etliche Jahre. Die im Buch vertretenen Autoren sind sich denn auch noch keineswegs einig über Begriffsgeschichte, bezeichnetes Phänomen oder auch nur Gegenmaßnahmen, doch immerhin ist die Souveränität des kriminologischen Diskurses schon so groß, daß niemand sich dazu herabläßt, an den zweifellos international prägendsten Gebrauch des Wortes "Stalker" zu erinnern, den ihm Andrej Tarkowski durch seinen gleichnamigen Film aus dem Jahr 1979 angedeihen ließ.
Anlaß für die nun einsetzende deutsche Diskussion des Phänomens ist die 2002 erfolgte Inkraftsetzung des Gewaltschutzgesetzes, das auch Stalking sanktioniert. Allerdings nicht in ausreichendem Maße, wie Volkmar von Pechstaedt bemängelt. Der Rechtsanwalt, der wie nahezu alle Autoren des Bandes für sich in Anspruch nimmt, die deutsche Diskussion über Stalking höchstpersönlich eröffnet zu haben, hat sich auf die Vertretung von entsprechenden Verfolgungsopfern spezialisiert, und er hat gravierende Einwände gegen die prozessuale Praxis, die in den zwei Jahren der Gültigkeit des Gewaltschutzgesetzes noch keine einheitliche Handhabung herausgebildet hat. So etwas muß einen an Berechenbarkeit richterlicher Praxis interessierten Advokaten natürlich besonders ärgern, aber die Fallgeschichten, die Pechstaedt seinen Ausführungen beigibt, lassen in der Tat erkennen, daß die Wirkung von Stalking auf die Verfolgten bislang wohl unterschätzt wurde.
Aber da ist ja noch der Psychologe Ulrich Kobbé, der in seinem Beitrag mahnt, daß man sich als Opfer mal nicht so haben solle. Der "Opferdiskurs", den Kobbé in der Stalking-Debatte (und damit unausgesprochen im ganzen restlichen Buch) am Werk sieht, sei hysterisch. "Diese ethisch-moralisch durchaus angreifbare Reaktionsweise tendiert dazu, den Stalker zu entmenschlichen und verdinglicht zu behandeln, ohne dabei die ethische Problematik seiner selbstgerechten Position des moralisierenden Recht-Habens zu erkennen, geschweige denn zu reflektieren." Heißt ins Deutsche gebracht: Regt euch nicht auf, ein kleiner Stalker steckt in uns allen, besonders in Dir, Leser, also laßt sie ruhig gewähren, ist ja alles nicht so schlimm.
Man kann kaum umhin, Kobbé einen eigenen Verfolger auf den Hals zu wünschen, auf daß er seine Toleranz belegen möge. Zumal er eher die Opfer für therapiebedürftig hält als die Täter. Dankenswerterweise scheint er damit ziemlich allein zu stehen. So hat die Kriminalbeamtin Susanne Ritter-Witsch aus ihrer Praxis einen Fall zu bieten, wo eine Frau, die ihre Beziehung zu einem Mann beendet hatte und dann von diesem verfolgt und belästigt wurde, nach beider Versöhnung eine Paartherapie mit dem Stalker begonnen hat, die der Therapeut jedoch bald für überflüssig erklärte, weil nur der Mann therapiebedürftig sei. Das spricht für die Psychologie. Aber solange man Autoren wie Kobbé auf Fragen wie "Macht nicht Stalking als Hybris des Subjekts, als exzessives ,passage à l'acte', das Extrem(e) jeder allgemeinen intersubjektiven Ordnung transparent? Steht nicht die quasi subversive Verwerfung der sozialen Konventionen gerade im Dienste der Aufrechterhaltung derselben Ordnung? Ist denn nicht in der beziehungsstrukturell angelegten intersubjektiven Überschreitung und besitzergreifenden Nähe just das garantiert, was wir zur einerseits Abgrenzung und Differenzierung, andererseits Identifizierung und Selbstfindung benötigen?" nicht dreimal kräftig "Nein" entgegenbrüllt, liegt etwas im argen in Deutschlands Diskussionskultur.
Der Rest des Buches - und das sind immerhin rund 275 Seiten - ist dagegen interessant, wenn auch bisweilen etwas redundant. Auch fragt man sich, was der Aufsatz zu "Männlichen Opfern" von Hans-Joachim Lenz darin zu suchen hat, wenn Stalking dort mit keinem Wort erwähnt wird. Aber da zuvor Constance Ohms recht abenteuerliche Differenzierungen zwischen heterosexuellen und lesbischen Stalkern vorgenommen hat, wollen wir einmal glauben, daß Männer es schwer haben. Auch so etwas muß wohl mal gesagt werden.
Aber wenn man dann erfährt, daß Stalker im Schnitt wesentlich älter sind als andere Delinquenten, daß ihr Anteil unabhängig ist von sozialer Zugehörigkeit und daß immerhin die Hälfte aller Stalker ihre Aktivitäten nach kurzer Zeit wieder einstellt und dadurch gar nicht erst in die Statistik eingeht, dann ergibt sich das Bild einer Verbrechensform - und um nichts anderes handelt es sich -, deren Umfang und Problematik noch immer nicht richtig erkannt worden sind. Deshalb ist das Buch trotz aller Mängel ein erfreuliches Pionierwerk, auch weil es manche Ratschläge für diejenigen enthält, die in ihrer dauerhaften Verfolgung doch etwas anderes erkennen wollen als das Äquivalent von "Fensterln" oder Kontaktanzeigen, wie Psychologe Kobbé vor sich hin plappert.
ANDREAS PLATTHAUS
Julia Bettermann, Moetje Feenders (Hrsg.): "Stalking". Möglichkeiten und Grenzen der Intervention. Verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt am Main 2004. VI und 304 S., br., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.04.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.04.2004