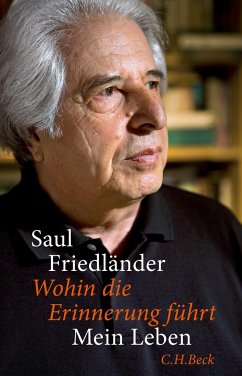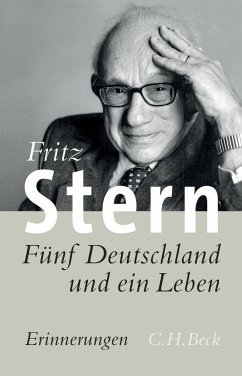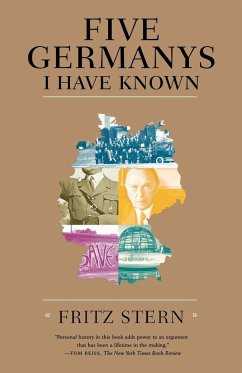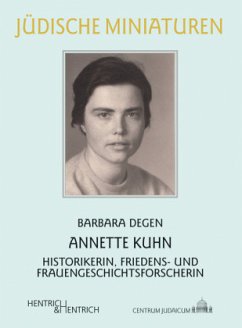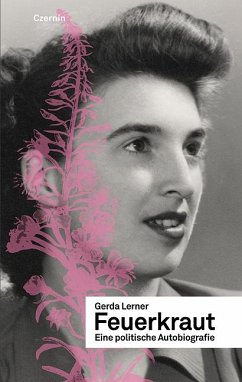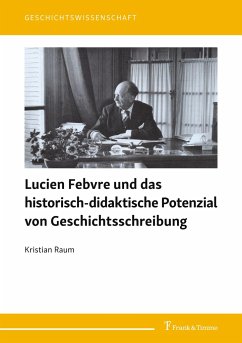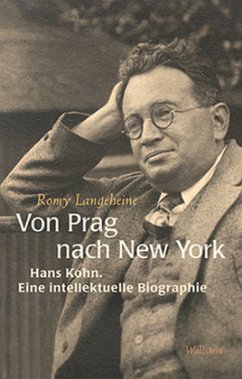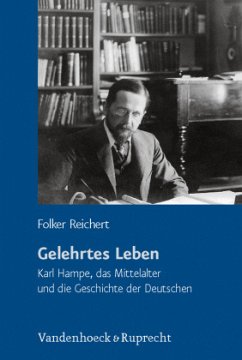de la haine" ("Brevier des Hasses") vor - die erste Gesamtdarstellung des nationalsozialistischen Verfolgungs- und Mordgeschehens an den europäischen Juden, in dem er vor allem den Antisemitismus als Ursache für den Völkermord ausmachte. Das Buch nimmt viele wichtige Forschungsthemen vorweg, über die erst Jahrzehnte später diskutiert wurde, etwa die Rolle der Wehrmacht beim Judenmord, die Psychologie der Täter oder die Massenerschießungen durch die Einsatzgruppen, die Poliakov als "exterminations chaotiques" den "exterminations méthodiques" in den Vernichtungslagern gegenüberstellt.
Während Poliakovs Frühwerk bis heute nicht auf Deutsch vorliegt, sind seine Memoiren nun erstmals übersetzt worden. Im Kern des Bandes stehen die schon 1946 von ihm verfassten Erinnerungen an die Jahre 1940 bis 1944. Nachdem sie lange unveröffentlicht blieben, erschienen sie 1981 zusammen mit einer später geschriebenen Vor- und Nachgeschichte der Kriegsjahre. Der französische Originaltitel "L'auberge des musiciens" verweist dabei auf einen der Orte, an denen Poliakov sich vor den Deutschen versteckte.
Der 1910 in St. Petersburg geborene Poliakov war im Alter von zehn Jahren mit seinen Eltern, die im russischen Bürgerkrieg auf Seiten der "Weißen" standen, über das Schwarze Meer nach Westeuropa geflüchtet. Die Poliakovs, eine jüdische Familie mit Wurzeln in Odessa, kehrten nie wieder nach Russland zurück. Nach drei Jahren in Berlin entschied sich der als Unternehmer tätige Vater für einen Umzug nach Paris, nachdem er während der Inflation in der Weimarer Republik einen Großteil seines Vermögens verloren hatte. Der junge Léon studierte Rechtswissenschaften an der Sorbonne und gründete mit seinem Vater das "Pariser Tageblatt", das sich in der Zeit seines Bestehens von 1933 bis 1936 an die deutsch-jüdische Exilgemeinde in der französischen Hauptstadt richtete. 1940 geriet Poliakov als französischer Soldat in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er jedoch fliehen konnte. Er tauchte unter und schloss sich der Résistance an. Die Schilderungen dieser Jahre präsentiert er in seinen Erinnerungen als "Abenteuergeschichte". Sie sind der erzählerisch lebendigste Teil der Memoiren.
Noch während des Krieges hatte Poliakov begonnen, Dokumente über die Verbrechen der deutschen Besatzer zusammenzutragen. In Marseille lernte der Agnostiker Poliakov den chassidischen Rabbi Salman Schneersohn kennen. Als dessen Cousin Isaac Schneersohn 1943 das "Centre de documentation juive contemporaine" gründete, wurde Poliakov zu einem seiner ersten Mitarbeiter. Als Motivation für sein Engagement als Leiter der Forschungsabteilung im "Centre" gab er später einmal lapidar an: "Ich wollte wissen, warum man mich töten wollte."
Das wissenschaftliche OEuvre des Autodidakten Poliakov umfasst mehrere Dutzend Bücher. In den fünfziger Jahren gab er zusammen mit Joseph Wulf drei Dokumentenbände zur Geschichte des "Dritten Reiches" und der Judenverfolgung heraus. Während Wulf, auch aus Enttäuschung über das fehlende öffentliche Echo auf seine Aufklärungsbemühungen, 1974 seinem Leben ein Ende setzte, führte Poliakov seine Forschungen fort und erwarb sich mit einer fünfbändigen "Geschichte des Antisemitismus" wissenschaftliche Anerkennung, die ihn zurück an die Sorbonne führte.
Poliakov, noch zu Lebzeiten als Ritter der Ehrenlegion ausgezeichnet, starb 1997. Dass seine Memoiren mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod in deutscher Übersetzung erscheinen, verdankt sich einem kleinen Berliner Verlag und der finanziellen Unterstützung der Pariser "Fondation pour la Mémoire de la Shoah". Vielleicht bringt sie ja einen größeren Verlag auf den Gedaken, die Übersetzung von Poliakovs Pionierarbeit "Bréviaire de la haine" in Angriff zu nehmen.
RENÉ SCHLOTT
Léon Poliakov: "St. Peterburg - Berlin - Paris". Memoiren eines Davongekommenen.
Aus dem Französischen von Jonas Empen, Jasper Stabenow und Alex Carstiuc. Edition Tiamat, Berlin 2019. 288 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
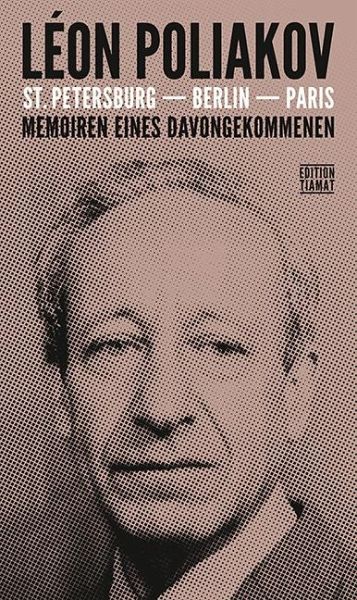




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.06.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.06.2019