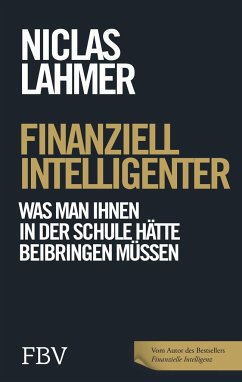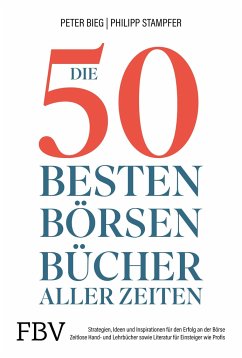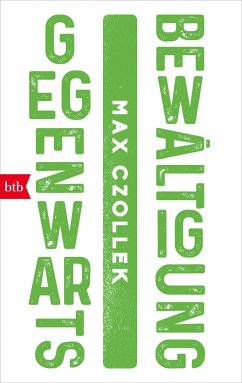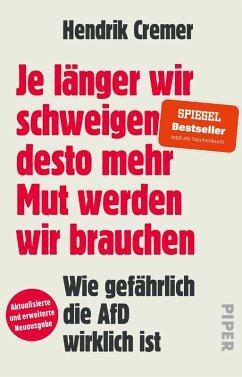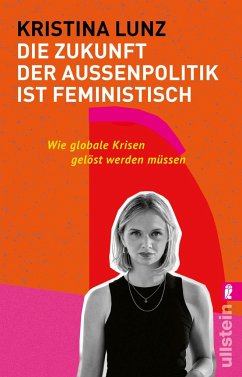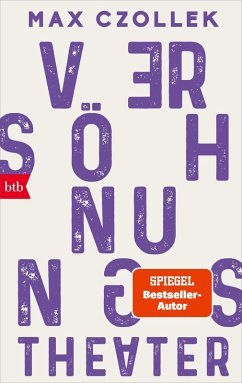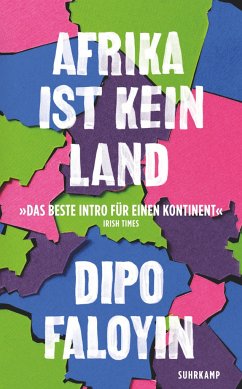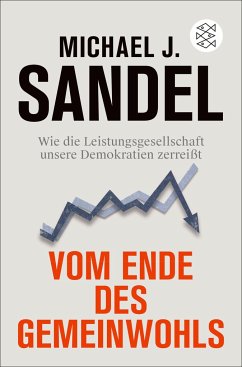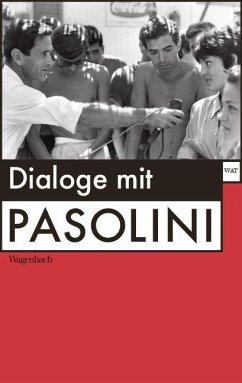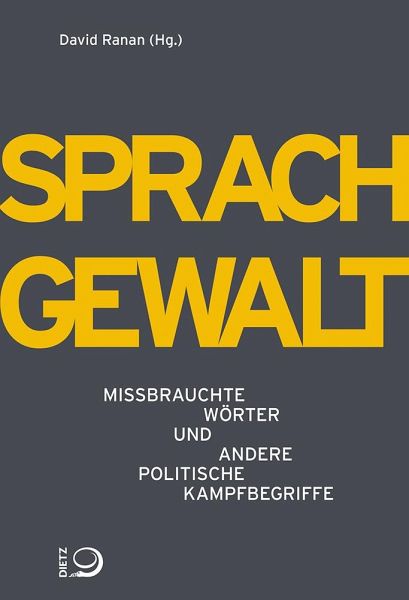
Sprachgewalt
Missbrauchte Wörter und andere politische Kampfbegriffe
Herausgegeben: Ranan, David
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
26,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Mit Sprache wird manipuliert, Macht und Gewalt ausgeübt. Fake News, über Medien verbreitet, schaffen Verunsicherung. Der Vorwurf Terrorist oder Antisemit kann über Karrieren, selbst über Leben und Tod entscheiden. Die Essays in diesem Band untersuchen zentrale politische Begriffe auf ihren Missbrauch. Wer benutzt sie wie, wann und wozu? Kritische Wachsamkeit ist geboten, wenn jemand die Welt mit ein paar Wörtern in Gut und Böse einteilt, Verbrechen entschuldigt, Gegner vernichtet und uns zu seinen Komplizen machen will. Freiheit, Demokratie, Islamismus oder Elite. Ist klar, was gemeint i...
Mit Sprache wird manipuliert, Macht und Gewalt ausgeübt. Fake News, über Medien verbreitet, schaffen Verunsicherung. Der Vorwurf Terrorist oder Antisemit kann über Karrieren, selbst über Leben und Tod entscheiden. Die Essays in diesem Band untersuchen zentrale politische Begriffe auf ihren Missbrauch. Wer benutzt sie wie, wann und wozu? Kritische Wachsamkeit ist geboten, wenn jemand die Welt mit ein paar Wörtern in Gut und Böse einteilt, Verbrechen entschuldigt, Gegner vernichtet und uns zu seinen Komplizen machen will. Freiheit, Demokratie, Islamismus oder Elite. Ist klar, was gemeint ist? Der Terrorist des einen ist der Freiheitskämpfer des anderen. Solche und andere politische Begriffe haben reale Wirkungen, obwohl sie unscharf und vieldeutig sind. Sie besitzen ein enormes Charisma. Das macht sie zu attraktiven Waffen im politischen Kampf. Post Truth und Sprachgewalt sind die Feinde der Demokratie. Der Versuch, uns zu täuschen, ist allgegenwärtig. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die das nicht wollen.Mit Beiträgen von Jonathan Alschech, Ruth Ben-Ghiat, Micha Brumlik, Rikki Dean, Marion Detjen, Jana Egelhofer, Marcus Funck, Christian Geulen, Amos Goldberg, Christoph Gollasch, Neve Gordon, Gregor Gysi, Michael Kohlstruck, Brian Klug, Gesine Krüger, Meltem Kulacatan, Peter Lintl, Daniel Morat, Nicola Perugini, Michael Quante, Barnaby Raine, David Ranan, Jörn Retterath, Jonathan Rinne, Mohammad A. Sarhangi, Stefanie Schüler-Springorum, Peter Steinbach, Marc Volovici, Yair Wallach, Anton Weiss-Wendt.