Sprache äußern, sich auf Sprachliches berufen, ohne sich bei der Disziplin kundig zu machen, die dafür zuständig ist. Dies gilt auch für die Philosophen, für Heidegger etwa oder für die sprachanalytische Philosophie insgesamt. Die "sprachliche Wende" in der Philosophie, der vielberufene und gefeierte "linguistic turn", war ja gerade keineswegs eine "linguistische". So wird sie zwar deutsch oft genannt, aber wir sollten zwischen "sprachlich" und "linguistisch" strikt unterscheiden, denn wir haben nun einmal, im Unterschied zum Englischen oder Französischen, zwei Ausdrücke für in der Tat recht Verschiedenes - und statt "linguistisch" kann man auch "sprachwissenschaftlich" sagen.
Unter den Sprachkritikern also ist Zimmer eine Ausnahme. Er selbst redet von "einer langen und überaus lohnenden Entdeckungsreise", die er da gemacht habe. Und von dieser bringt er für dieses Buch einiges mit und präsentiert kundige Beiträge, die sich nun wieder von denen der Sprachwissenschaft dadurch unterscheiden, daß sie zwischen Wichtigem und weniger Wichtigem klug sortieren und sich auf Wissenschaftsprotzerei, also auf Szientismus, denn davon gibt es in der Linguistik allzuviel, nicht einlassen. Oder: Zimmer eliminiert dies. Zudem schreibt er vorzüglich, nämlich klar und energisch. Auch damit tun sich die Sprachwissenschaftler eigentümlich schwer.
Das Buch hat zwei ungefähr gleich lange Teile. Im ersten geht es um "Meinungsverschiedenheiten", und da wird als erstes gerade der "folgenreiche Dissens" zwischen Sprachkritik und Sprachwissenschaft behandelt. Dann geht es um das, was Zimmer hübsch als "PSA" bezeichnet, das "private spontane Alltagsschriftdeutsch", das sich etwa und vor allem im Internet findet, in "diversen Beratungs-, Selbsthilfe- und Klatschforen". Da stellt er ein bemerkenswertes Korpus zusammen und untersucht es - durchaus bewertend, was die Sprachwissenschaft nicht tun will oder kann; da steckt ein Problem. Dann geht es, dieses Thema ausweitend, um den "beschränkten Code" oder schließlich, mit klarer Wertung, um die "geringe Schreibkompetenz, die einem aus dem Internet entgegenstammelt". Dann - und sehr gut - um die Anglizismen; schließlich um die Rechtschreibreform.
Der zweite (noch einheitlichere) Teil befaßt sich aufschlußreich mit einem Grundproblem, übrigens weit mehr und zu Recht der Philosophie als der Sprachwissenschaft, die hier aber viel beizutragen hat: dem Verhältnis von "Denken & Sprechen". Auch hier hat sich Zimmer (und auch mit ganz Neuem) kundig gemacht. Und wieder: Kein Sprachwissenschaftler würde dies so und so aufs Notwendige reduziert zusammenstellen. Da bewährt sich der Blick von außen.
Dezidiert anderer Meinung ist der Rezensent nur im Blick auf die Rechtschreibreform, angefangen damit, daß hier nun wirklich kein "dringender Handlungsbedarf" war. Die wirklichen Motive der "Reform" lagen ganz woanders - nicht in der Sache jedenfalls. Aber vernünftig, muß man konzedieren, bleibt Zimmer auch hier. Seltsam, daß er die Reform stramm verteidigt, dann aber am Ende - oder ist dies bloß wieder pragmatisch vernünftig? - seitenlang anführt, was freilich nun doch wieder geändert werden sollte, und zwar dringend. Hoffen wir, mit ihm, auf Hans Zehetmair!
Übrigens hat sich, dies wäre gegenüber Zimmer nachzutragen, die Szene im Blick auf die Sprachkritik in der Sprachwissenschaft in den letzten Jahren geändert. Heute findet man da nach wie vor die alte strikte Ablehnung ("Laß deine Sprache in Ruhe!", "Leave your language alone!" - so ein schlagender Titel, 1950, von Robert A. Hall, eines klassischen und dazu ziemlich sturen Strukturalisten), dann die Ignorierung der Sprachkritik, dann, schon offener, ihre Berücksichtigung in der Beschreibung, dann dies, daß auch einzelne Linguisten sprachkritisch mit ihrem linguistischen Wissen hervortreten, mit dem Bewußtsein jedoch und dem klaren Signal, die Wissenschaft zu verlassen, weil es hier einen sprachwissenschaftlichen Begründungsnotstand gibt (man kann, was man sprachkritisch will oder nicht will, zuallermeist sprachwissenschaftlich nicht begründen), schließlich gibt es neuerdings einzelne Linguisten, die nun gerade als Linguisten, also nun innerhalb der Sprachwissenschaft, Sprachkritik zu betreiben suchen (Jürgen Schiewe etwa, der eben auch eine linguistische Zeitschrift mit diesem Ziel gegründet hat).
Der Leser erfährt in diesem Buch also zu wichtigen und aktuellen Sprachthemen vieles und Vernünftiges. Und für den zweiten Teil, in dem die Sprachkritik in den Hintergrund tritt, gilt dies vielleicht noch mehr. Da geht es unter anderem um diese Fragen: Wie denken wir? Sprachlich oder halbsprachlich, in Bildern? Gibt es eine Sprache des Geistes - "Mentalesisch" - über oder hinter den einzelnen Sprachen? Wie kommt es zu Versprechern? Bei dieser Frage tritt wieder Zimmers Freud-Tick hervor. Schwer zu sagen, weshalb er den Mann für einen Schwachkopf hält. Jedenfalls ist Freuds Theorie der Versprecher anders, als Zimmer es sagt.
Dann: Ist wirklich jede Sprache, wie Humboldt meinte, eine besondere "Weltansicht"? Weiter: Wie muß man sich die Bedeutung eines Wortes vorstellen? Wie entsteht sie im Gehirn? Ist die Sprache angeboren? Ist sie, wie Chomsky lehrt, ein "natürlicher", also ein naturwissenschaftlicher Gegenstand? Oder ist eine Sprache ausschließlich geschichtlich und also kulturell? Gibt es Unterschiede in der "Leistungskraft" der Sprachen? Die Linguistik, sagt Zimmer, habe dies nicht untersucht. Ganz stimmt es nicht mehr, denn wir haben jetzt die Lehre vom möglichen "Ausbau" einer Sprache (zum Beispiel zu einer "Schriftsprache"), die es auch erlaubt, Sprache und Dialekt zu trennen. Vom stattgehabten "Ausbau" hängt die "Leistungskraft" eines Idioms ab. Zimmer schließt: "Die Bewertungsphobie der Linguistik kommt zwar im Namen des wissenschaftlichen Objektivitätsgebots . . . daher, ist jedoch selber hochgradig ideologisch kontaminiert." So ist es wohl nicht ganz richtig, aber es ist doch einiges dran. Dann der letzte Satz, und dieser ist nun ganz richtig: "Laß deine Sprache nicht allein." Nicht seine Sprache, aber doch sein eigenes Sprechen (und Schreiben) hat ja jeder in seiner Hand. Ein wichtiges Buch!
HANS-MARTIN GAUGER
Dieter E. Zimmer: "Sprache in Zeiten ihrer Unverbesserlichkeit". Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2005. 368 S., geb., 23,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
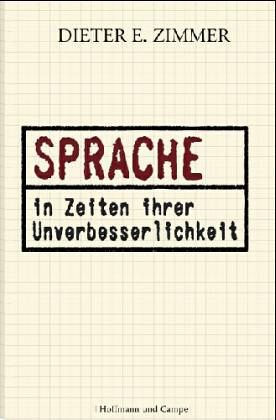




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.02.2006